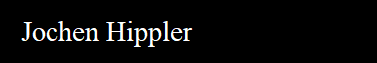

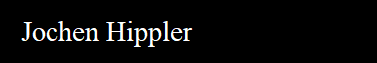 |
 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Versöhnung und Reintegration: Jochen Hippler
Die internationale Afghanistanintervention seit Herbst 2001 richtet sich - außer gegen die örtliche Präsenz von al-Qaida - gegen die Taliban. Diese sollten gestürzt und durch ein demokratisches Regime ersetzt werden. Gespräche, Verhandlungen und Kooperation mit ihnen wurden für einige Jahre prinzipiell ausgeschlossen. Lange war es innenpolitisch wie außenpolitisch ausgesprochen riskant, Gespräche mit den Aufständischen als Option auch nur zu erwähnen. Im Zuge der schrittweisen, dramatischen Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan seit 2004/2005 wurde klar, dass die Taliban und andere Aufständische weder politisch ignoriert noch militärisch geschlagen werden konnten. Seitdem hat sich die Diskussion verschoben: Waren zuerst Gespräche oder gar Verhandlungen undenkbar, dann vereinzelt von Dialogprozessen mit „gemäßigten“ Taliban die Rede, so wird heute öffentlich über eine „Versöhnung“ mit den Aufständischen und eine „Verhandlungslösung“ mit den Taliban nachgedacht. Tatsächlich finden inzwischen zumindest informelle Gespräche zwischen der afghanischen Regierung, den USA und den Taliban statt. Militärischer Sieg und politische Lösung Ein Verständnis des Afghanistankrieges setzt daneben auch die Erkenntnis voraus, dass es sich vor allem um eine politische Auseinandersetzung handelt, die militärisch nicht entschieden werden kann. Selbst der skrupellose Einsatz militärischer Macht durch die Sowjetunion - mit über einer Million Toten - bewahrte diese nicht vor einer Niederlage, weil es ihr nie gelang, eine von der Gesellschaft akzeptierte Regierung zustande zu bringen. Auch die NATO hat keine Chance, den Krieg militärisch zu gewinnen, weil die Anwendung militärischer Gewalt in diesem Krieg zwar taktisch bedeutsam, strategisch aber nebensächlich ist. Anders ausgedrückt: Auch wer alle Schlachten gewinnt, kann trotzdem den Krieg verlieren. Deshalb ist auch die Fokussierung der Debatte auf eine Aufstockung oder eine Verringerung ausländischer Truppen wenig sinnvoll. Der Einsatz von mehr oder weniger Truppen kann taktische Erleichterung bringen, aber keinen „Sieg“. Dies liegt unter anderem am spezifischen Charakter des Krieges bzw. dieser Art von Krieg, die bereits an anderer Stelle vertiefend skizziert wurden. Die Unmöglichkeit eines militärischen Sieges ist inzwischen auch denen einsichtig, die ihn zuerst als selbstverständlich voraussetzten. Dies führte zu zwei Denkmustern, die zum Teil als komplementär, zum Teil aber als Alternativen betrachtet werden: Einmal zu einer Perspektive des Abzugs der ausländischen Truppen, vorzugsweise schrittweise und unter der Bedingung einer weiteren Existenz der gegenwärtigen afghanischen Regierung; zweitens zu der Perspektive, den Krieg auf eine andere, politischere Weise zu führen, um ihn doch noch für sich zu entscheiden - oder ihn zumindest nicht zu verlieren. Der Gegensatz beider Positionen scheint auf der Hand zu liegen: Ein Truppenabzug ist zuerst einmal etwas anderes als eine effektivere Form des Krieges, die möglicherweise gar eine Zeit lang mehr Truppen erfordern könnte. Er löst sich aber teilweise auf, wenn die Effektivierung des Krieges als Mittel betrachtet wird, die Voraussetzungen für einen Truppenrückzug erst zu schaffen. Zumindest die neue Politik der Regierung unter Präsident Obama bemüht sich um diesen Ausweg: Eine Umstellung des Krieges auf Counterinsurgency (Aufstandsbekämpfung, die eher politisch angelegt ist, aber mehr Truppen zur Flankierung erfordert), ab Mitte 2011 dann ein schrittweiser Truppenrückzug, der sich allerdings einige Jahre hinziehen soll. Der in Deutschland übliche Euphemismus dafür lautet: „Rückzug in Verantwortung“. Gemeint ist ein langsamer Truppenabzug, der mit einer graduellen Übergabe der Zuständigkeit für die Sicherheitslage an die afghanische Regierung synchronisiert wird. Die Achillesferse dieser Vorstellung liegt in der offenen Frage, ob die afghanische Regierung in absehbarer Zeit - oder jemals - in der Lage sein wird, selbst die Aufständischen niederzuhalten. Es ist offensichtlich, dass die westliche Politik sich einen Abzug ihrer Truppen unter Bedingungen des Scheiterns nicht vorstellen kann - oder es zumindest nicht möchte. Die amtlichen Vorstellungen eines angesichts der Unmöglichkeit des militärischen Sieges an sich nötigen und erstrebten Abzuges hängen also im Kern davon ab, ob zuvor eine Stabilisierung der politischen und militärischen Lage in Afghanistan gelingt - was das Paradoxon impliziert, genau dafür trotz allem einen Sieg zu benötigen, der doch militärisch inzwischen ausgeschlossen wird. Prinzipiell bedeutet dies, dass ein entsprechender Erfolg nicht mehr militärisch, sondern politisch erreicht werden soll. Das Militär soll in diesem Zusammenhang nur entsprechende politische Prozesse absichern, aber nicht mehr die Entscheidung bringen. Probleme politisch-militärischer Counterinsurgency Die erste Option zur Beantwortung dieser Fragen besteht im Konzept von Counterinsurgency, das seit Januar 2010 auf Vorschlag der US-Regierung von der internationalen Gemeinschaft übernommen wurde. Prinzipiell zielt es darauf, die Aufständischen politisch zurückzudrängen, indem ihnen durch die Schaffung legitimer Staatlichkeit der Boden entzogen werden soll. Die Auseinandersetzung mit den Taliban und anderen aufständischen Gruppen (vor allem: Hisb-e-Islami und Haqqani-Netzwerk) wird demnach primär als Konkurrenz um die Gewinnung der Loyalität der Bevölkerung und um Legitimität aufgefasst. Zur Erreichung dieses Zieles spiele das internationale und afghanische Militär eine wichtige, vor allem aber eine flankierende Rolle. Im Kern gehe es darum, durch eine Abfolge von clear, hold and build in wichtigen Regionen die Aufständischen erst zu vertreiben (oder zu vernichten), dann aber diese Gebiete nicht mehr zu räumen (wie dies früher aufgrund des Ansatzes von search and destroy eher die Regel war), sondern zu halten - und auf dieser Grundlage einen politischen und gesellschaftlichen Wiederaufbau voranzutreiben, der insbesondere im Aufbau funktionierender und legitimer staatlicher Organe sowie in der Bereitstellung von Infrastruktur bestehen soll. Um dies zu erreichen, und insbesondere die von Aufständischen „gesäuberten“ Gebiete dauerhaft zu halten, bis die staatliche Infrastruktur funktioniert und man die Bevölkerung für sich gewonnen hat, ist ein wesentlich größerer Bestand an militärischem Personal erforderlich, als wenn es nur um das Aufspüren und Vernichten von Widerstand gehen würde, was zum Teil aus der Luft erreicht werden könnte. Das ist der Hintergrund für die massive Aufstockung der US- und internationalen Truppen seit dem Amtsantritt Präsident Obamas. Zugleich fokussiert dieses Vorgehen auch auf die umfassende Verstärkung des afghanischen Sicherheitspersonals. Dabei geht es um die Unterstützung der internationalen Truppen, um die Vermeidung des Anscheins eines ausländischen Besatzungsregimes, indem der direkte Kontakt mit der Bevölkerung primär durch afghanische Polizisten und Soldaten erfolgen soll und um die Schaffung der Voraussetzung dafür, die „Sicherheitsverantwortung“ mittelfristig auf die afghanische Regierung übertragen und die eigenen Truppen reduzieren und dann abziehen zu können. Diese neue Strategie ist insgesamt plausibel, insbesondere im Vergleich zur früheren Konzeptionslosigkeit der westlichen Kriegführung. Allerdings ist ihr Erfolg alles andere als gesichert. Es bestehen insbesondere zwei strategische Grundprobleme, für die bisher noch keine Lösungen absehbar sind: Einmal hängt in diesem Konzept alles vom Erfolg des Aufbaus legitimer afghanischer Regierungsstrukturen ab. Dieser Prozess kann allerdings durch ausländische - militärische wie zivile - Kräfte nur unterstützt, aber nicht selbst zustande gebracht werden. Das NATO-Militär (und zivile ausländische Organisationen) können dabei also nur fördern, unterstützen und bestimmte Voraussetzung schaffen (finanzieller oder sicherheitspolitischer Art), den Erfolg aber nicht selbst gewährleisten. Ob afghanische Richter oder Politiker beispielsweise korrupt sind, ob afghanische Polizisten foltern oder stehlen - solche grundlegenden Merkmale legitimer Staatlichkeit können durch ausländische Resolutionen oder militärische Präsenz nicht geschaffen werden, sondern hängen am politischen Willen und der Kompetenz der afghanischen Regierung und Behörden. Genau auf dieser – letztlich entscheidenden - Ebene müssen für die letzten Jahre sogar eher negative Tendenzen festgestellt werden. Der afghanische Staat und die afghanische Regierung haben heute deutlich weniger Legitimität als noch vor fünf oder sechs Jahren. Die Wahlfälschungen durch die Regierung, die starke Einbeziehung krimineller Warlords in die Regierung auf allen Ebenen, die exzessive Korruption und die Verwicklung in den Drogenhandel (nicht allein durch den Bruder des Präsidenten), das oft räuberische Verhalten afghanischer Polizeieinheiten und nicht zuletzt auch die zivilen Opfer durch westliche Militäroperationen haben neben anderen Faktoren die Legitimität des Staates - und der westlichen Militärpräsenz - untergraben. Demgegenüber sind die Fortschritte beim Aufbau funktionierender Staatlichkeit außerhalb der großen Städte eher gering, sie verlaufen langsam und widersprüchlich. Politisch bedeutet dies, dass die Regierung Karzais zwar finanziell, militärisch und politisch sehr stark von der internationalen Gemeinschaft - insbesondere den USA - abhängig sein mag, dass die Abhängigkeit aber umgekehrt mindestens ebenso groß ist: Ohne den politischen Willen und die Fähigkeit der afghanischen Regierung zu einer grundlegenden Reform wird der afghanische Staat nicht in der Lage sein, in den Augen der Bevölkerung Legitimität zu gewinnen und eine loyale Einstellung zu erzeugen. Und ohne dies fehlen der westlichen Afghanistanpolitik die entscheidenden Erfolgsvoraussetzungen. Zugleich sind die Druckmöglichkeiten der NATO-Länder zur Erzwingung entsprechenden Reformen höchst begrenzt: Die Drohung eines Einstellens der militärischen und finanziellen Unterstützung für Präsident Karzai ist so lange unglaubwürdig, wie die Taliban mit allen Mitteln von der Macht ferngehalten werden sollen. Präsident Karzai ist sich sehr bewusst, dass er trotz seiner Wahlfälschungen und anderen Missbräuchen sowie seines fehlenden politischen Reformwillens für die westlichen Regierungen immer noch das bei weitem kleinere Übel gegenüber den Taliban und anderen Aufständischen darstellt - und dass westliche Drohungen, seine Unterstützung von der Erfüllung bestimmter Kriterien und yardsticks abhängig zu machen, bisher nicht mehr als Bluff waren und sind. Aufgrund der geostrategischen Interessendefinition Washingtons („Krieg gegen den Terror“, auch wenn diese Formulierung unter Obama kaum noch benutzt wird) ist es Karzai gelungen, die westliche Politik zur Geisel seines Regimes zu nehmen. Ohne eine Neudefinition der westlichen Interessen und politischen Ziele in der Region sowie der Bereitschaft, auch eine von den Taliban wesentlich beeinflusste Nachfolgeregierung zu akzeptieren, wird sich daran nichts ändern - und damit fehlt der westlichen Politik weiterhin eine entscheidende Erfolgsvoraussetzung. Eine solche Umorientierung westlicher Politik ist schwierig und bisher weder erkennbar noch zu erwarten. Ohne einen legitimen Staat in Afghanistan ist die militärische Unterstützung und Stabilisierung des Landes wenig aussichtsreich – einen solchen gibt es aber bisher nicht. Die zweite Achillesferse der neuen westlichen Afghanistanstrategie besteht in der zukünftigen Rolle des afghanischen Sicherheitsapparates. Die Gründe seines massiven Ausbaus wurden bereits angesprochen. Allerdings ist diese Politik höchst riskant. Ihr Erfolg hängt einerseits von der dauerhaften Bereitschaft und Fähigkeit der NATO-Länder ab, ihn zu finanzieren und zu organisieren, da die erforderlichen Mittel die Fähigkeiten und Ressourcen des afghanischen Staates im hohem Maße übersteigen. Inzwischen ist in Washington bereits von 300.000 oder gar 400.000 afghanischen Soldaten und Polizisten die Rede. Dies mag militärisch-pragmatisch sinnvoll oder plausibel erscheinen, führt aber zu einem politisch-strategischen Schlüsselproblem: Falls ein solch massiver Aufbau des afghanischen Sicherheitsapparats gelingen sollte (es also bis zu 400.000 gut ausgebildete, bewaffnete, disziplinierte und dauerhaft extern finanzierte Soldaten und Polizisten geben würde), dann stünde einem solchen in Afghanistan historisch beispiellosen Repressionsapparat weiterhin ein schwacher, inkompetenter und auf dem Land oft nur in homöopathischen Dosen vorhandener ziviler Staat gegenüber. Anders ausgedrückt: Es entstünde die Gefahr, dass nicht der afghanische Staat über das Militär verfügt, sondern umgekehrt das Militär den Staat dominiert und kontrolliert. Eine solche direkte oder indirekte Militärherrschaft würde aber nicht nur die staatliche Legitimität weiter untergraben (von demokratischen Restansprüchen ganz zu schweigen), sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit von der afghanischen Gesellschaft nicht akzeptiert. Sogar schwächere politische Systeme als ein solches militärisches Monstrum wurden in der afghanischen Geschichte immer wieder mit der Waffe bekämpft. Ein Erfolg dieses militärischen Aufbaus würde also mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer neuen Runde des Bürgerkriegs führen, da die afghanische Gesellschaft eine direkte oder indirekte Militärdiktatur kaum ohne Widerstand akzeptieren wird. Andererseits: Falls die internationale Gemeinschaft eine solche Aufrüstung irgendwann einmal nicht mehr zu finanzieren bereit sein sollte - was nach einem Abzug der eigenen Truppen mit einigen Jahren Verzögerung zu erwarten ist - dann bestünde die Gefahr, dass Hundertausende Bewaffneter ohne Einkommen bleiben würden. Ein solches Szenario wäre kaum besser als das vorige: Denn dann würde diesen kaum etwas anderes übrig bleiben, als sich selbst um ihren Lebensunterhalt zu kümmern - ohne etwas anderes gelernt zu haben als Krieg. Die Fragmentierung des Sicherheitsapparates wäre dann eine realistische Möglichkeit wie auch die Nutzung der daraus hervorgehenden bewaffneten Banden für organisierte Gewaltkriminalität (Drogenökonomie, Entführungen/Erpressungen, Raub und Plünderungen) durch Warlords oder extremistische und terroristische Netzwerke, die alle ein großes Interesse an gut ausgebildeten und bewaffneten Kämpfern haben. Auch dieses Szenario würde eine Verewigung des Krieges bedeuten - aber in beiden Fällen ohne eine militärische Beteiligung westlicher Truppen, die ja bereits vorher das Land verlassen haben dürften. Versöhnung und Verhandlungen „Versöhnung“ als taktisches Mittel hat wenig mit einer tatsächlichen Versöhnung zwischen Kriegsparteien zu tun. Als solche würde sie ein gegenseitiges Akzeptieren als prinzipiell Gleichwertige, einen Versuch des fairen Interessenausgleichs, eine zumindest teilweise Überwindung festsitzender Feindbilder und die Entwicklung gemeinsamer Vorstellungen für die Gestaltung der Nachkriegszeit beinhalten. All dies ist aber nicht gemeint, wenn „Versöhnung“ als taktisches Instrument zur Anwendung kommen soll. Der Kern von „Versöhnung“ in der gegenwärtigen Strategie besteht vielmehr darin, Teile der Aufständischen, insbesondere ihrer ideologisch weniger interessierten sozialen Basis, dem Aufstand und seiner Führung zu entfremden, sie durch wirtschaftliche und andere Anreize zur Neutralität oder zum Überlaufen zu bewegen und auf dieser Basis in den von der Regierung und den ausländischen Akteuren dominierten politischen und gesellschaftlichen Rahmen zu reintegrieren. Es geht also letztlich um die Schwächung der Aufständischen, indem man Teile ihrer unteren Kader, Kämpfer oder Mitläufer durch materielle oder politische Anreize faktisch herauskauft, um auf diese Art den verbliebenen, harten Kern der Aufständischen besser bekämpfen zu können. Dies mag zweckmäßig sein und wird bereits seit Jahren versucht, aber mit „Versöhnung“ in eigentlichen Wortsinn hat diese Strategie wenig zu tun. Die Bezeichnung klingt politisch besser, als wenn von einem „Überläuferprogramm die Rede wäre. Den Aufständischen wird gerade nicht die Hand zur Verständigung gereicht, sondern der Versuch ihrer Spaltung und Schwächung unternommen, was diesen nicht entgeht. Versöhnung wird so sicher nicht erreicht, sondern eher erschwert. Dazu kommen zwei eher pragmatische Probleme. Einmal wird der tatsächliche Erfolg eines wirksamen Programms zur Reintegration von Überläufern nicht allein durch materielle Belohnungen bedingt - auch wenn diese durchaus wichtig sein können. Nicht nur in Afghanistan hängt die Loyalität von Kämpfern - wie auch von potentiellen Überläufern - zu einem hohen Teil von der Einschätzung ab, welche Seite sich im Krieg mittel- und längerfristig durchsetzen wird. Ein Überlaufen zum Gegner ist nicht attraktiv, wenn man ihm den letztendlichen Sieg nicht zutraut oder wenn er auf andere Weise politisch abschreckend erscheint. Sich einem Verlierer anzuschließen ist riskant und wenig verlockend, während sich der Seite des zukünftigen Siegers anzuschließen zahlreiche Vorteile verheißt, die einen kurzfristigen materiellen Gewinn übertreffen. Solche pragmatischen oder opportunistischen Erwägungen sprechen aber eher gegen einen ernsthaften Frontwechsel von Talibankämpfern. Der illegitime Charakter des Karzai-Regimes und die Tatsache, dass die Aufständischen bisher weder von der Regierung noch vom mit Abstand stärksten Militärbündnis der Welt besiegt werden konnten, sondern an Stärke eher zunahmen, dürfte dazu beitragen, dass ein Überlaufen zur Regierung sicher nicht zum Massenphänomen werden wird. Damit hängt ein zweites Problem zusammen. Wenn im Kontext einer schwachen, unbeliebten und von ausländischen Soldaten an der Macht gehaltenen Regierung politische Gründe zum Anschluss an diese eher gering sind (auch wenn sie vor allem aus lokalen Bedingungen heraus immer wieder vorliegen mögen), dann nehmen die materiellen Anreize eine Schlüsselrolle ein. Diese erscheinen aber nicht allein den Kämpfern der Aufständischen attraktiv, sondern auch und erst Recht, den an den Kämpfen nicht oder nur marginal beteiligten Männern in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Zusammengenommen ergibt sich hier das Szenario, dass viele Talibankämpfer nicht ernsthaft überlaufen werden, sondern entweder nur zum Schein oder kurzzeitig, um so in den Genuss materieller Vorteile zu kommen. Und es deutet vieles darauf hin, dass sich Männer aus dem gleichen Grund als Talibankämpfer ausgeben, obwohl sie dies tatsächlich nicht sind. So können Regierung und NATO insgesamt mehr oder weniger eindrucksvolle Zahlen von Überläufern vorweisen, ohne dass das „Versöhnungs“-Programm seine intendierte Wirkung entfalten würde. Ähnlich problematisch sieht es bezüglich eines taktischen Umgangs mit Verhandlungen mit den Aufständischen aus. Bisher erfolgen diese fast ausschließlich auf einer lokalen oder regional eng begrenzten Ebene, um örtliche, pragmatische Abkommen zu schließen, etwa um zeitlich begrenzte Waffenstillstände oder die Durchführung konkreter entwicklungspolitischer Maßnahmen zu ermöglichen. Solche Verhandlungen und Abkommen sind richtig und vernünftig - haben aber nichts mit einer Konfliktlösung durch Verhandlungen zu tun. Sie führen im besten Fall zu - wünschbaren - zeitweiligen, lokalen Regeln der Kriegführung, aber nicht zu einem Ende des Krieges. Eine Verhandlungslösung zur Kriegsbeendigung müsste - wenn gewünscht und möglich - mit den Führungen aller Gruppen von Aufständischen getroffen werden, nicht nur zur Lösung lokaler Probleme. Damit gelangen wir zur Frage, ob es möglich ist, Versöhnung und Verhandlungsbereitschaft von der taktischen auf die strategische Ebene zu heben, also als Mittel der Konfliktlösung und zur Beendigung des Krieges zu nutzen. Eine solche Option würde sicher nicht ohne politische Kosten zu haben sein: Sie würde auf die Teilung der Macht mit den Taliban, der Hisb-e-Islami und dem Haqqani-Netzwerk hinauslaufen und die Frage aufwerfen, ob dies nicht schon früher und mit wesentlich geringeren menschlichen Opfern und materiellen Kosten möglich gewesen wäre. Außerdem müsste man die früheren Ansprüche auf Demokratisierung und eine Verbesserung der Situation der afghanischen Frauen auch offiziell begraben. Aber dies ist nicht alles. Es ist vielmehr fraglich, ob eine solche Option realistischer ist als die Chimäre eines militärischen Sieges. Zwei Gründe sollten vor übertriebenem Optimismus warnen. Einmal spricht mehr dagegen als dafür, dass die Aufständischen einen solchen Weg zum Frieden zu gehen bereit sind. Aus ihrer Sicht stellt sich die Lage ja ausgesprochen positiv dar: Zwar werden sie die NATO in offener Feldschlacht keinesfalls besiegen können - aber das brauchen sie auch nicht, ebenso wenig, wie sie die sowjetischen Besatzungstruppen besiegen mussten, um den damaligen Krieg zu gewinnen. Aus ihrer Perspektive brauchen sie vor allem Geduld, um die weitere Erosion der Regierung und schließlich den Abzug westlicher Truppen abzuwarten, der zudem bereits angekündigt ist. In einem solchen Kontext spricht nichts gegen Gespräche - sie würden die Aufständischen zusätzlich legitimieren und den Interventen den Abzug erleichtern. Aber Gespräche sind etwas anderes als ernsthafte Verhandlungen - und Verhandlungen führen nicht notwendigerweise zu einem Abkommen. Und selbst ein Abkommen garantiert noch nicht, dass dieses auch tatsächlich umgesetzt wird. Die Taliban können mit gutem Grund davon ausgehen, dass die Zeit zu ihren Gunsten arbeitet. Weder die politische noch die militärische Lage zwingt sie dazu, Frieden zu schließen. Aus der Perspektive Präsident Karzais ist die Lage etwas komplizierter. Will er seine Machtposition erhalten, müssen ihm zwei Dinge zugleich gelingen: Einerseits muss es ihm innenpolitisch darum gehen, sein Image als Statthalter der Ausländer zu korrigieren und eine gewisse Selbständigkeit von diesen zu demonstrieren. Dazu sind Erklärungen und Gesten nützlich, die diese punktuell kritisieren und seine Bereitschaft andeuten, auf seine innerafghanischen Gegner zuzugehen. Diesem Zweck dienen Gesprächsangebote in Richtung Taliban. Zugleich können solche Angebote oder konkrete Gespräche seinen Spielraum gegenüber Washington graduell ausweiten. Andererseits muss er aufgrund seiner innenpolitischen Schwäche alles daransetzen, die materielle und militärische Unterstützung der NATO-Länder zu erhalten. Ein Friedensschluss und eine Koalition mit den Taliban würde die Bereitschaft der USA und Europas, sich im gegenwärtigen hohen Maß zu engagieren, allerdings mittelfristig schwächen. Zugleich ist es alles andere als sicher, ob eine Verständigung mit den Aufständischen mehr wäre als ein erster Schritt, ihn von der Macht zu verdrängen, was entschieden nicht in seinem Interesse liegt. Insgesamt deutet alles darauf hin, dass weder die Regierung noch die Aufständischen ein Interesse daran haben, aufgrund von Verhandlungen und eines ernsthaften Versöhnungsprozesses Frieden zu schließen - auch wenn beide Seiten sich durchaus offen für Gespräche zeigen, um Zeit und Legitimität zu gewinnen. Nach allen vorliegenden – bruchstückhaften – Informationen zu den bisherigen Gesprächen mit den Aufständischen handelt es sich nicht um Verhandlungen über einen Friedensschluss, sondern um informelle Gespräche in der Absicht, taktische Positionsvorteile zu erlangen. Daneben tritt ein weiteres Problem auf, wenn der Krieg durch ein anzustrebendes Friedensabkommen beendet werden soll. Beide Konfliktparteien sind höchst heterogen und bestehen aus losen Verbindungen unterschiedlichster und widersprüchlichster Gruppen. Die zahlreichen mit der Regierung verbundenen oder von dieser unabhängigen Warlords und lokale Größen mit ihrem militärischen Potenzial sowie die zahlreichen bewaffneten Gruppen der Aufständischen werden insgesamt nicht zentral kontrolliert. Es ist alles andere als sicher, dass ein zentrales Friedensabkommen auf höchster Ebene - etwa zwischen der Regierung bzw. dem Präsidenten und der Taliban-Führung - überall und durch alle Gewaltakteure beachtet würde oder ob zahlreiche spoiler sich einer solchen Lösung widersetzten. Schließlich kämpfen in Afghanistan nicht zwei sich gegenüberstehende, disziplinierte Armeen einen konventionellen Krieg gegeneinander, sondern lose verbundene, bewaffnete Netzwerke, deren Elemente oft schwer zu kontrollieren und disziplinieren sind. So wird ein Friedensschluss durch ein Abkommen und Versöhnung nicht unbedingt erleichtert. Fazit Sollte dies versäumt werden oder misslingen - und gegenwärtig deutet vieles in diese Richtung - dann dürfte weder eine Verstärkung noch der Abzug der ausländischen Truppen den Krieg beenden. Am wahrscheinlichsten ist in diesem Fall die Fortsetzung des multipolaren Krieges bei schrittweise zurückgehendem internationalem Engagement. Ausländische Wirtschafts- und Militärhilfe würde das Überleben der gegenwärtigen Regierung noch einige Zeit verlängern, während sich der Prozess ihrer politischen Erosion bereits nach einigen Monaten verstärken dürfte. Dann aber würde aufgrund einer instabilen Neukonfigurierung der lokalen und regionalen Gewaltakteure die politische Basis der Regierung Karzais zu schmal werden und eine lockere Koalition anderer Kräfte eine neue Regierung bilden, über deren Stärke noch nichts auszusagen ist. Auch ob einem solchem Regime die Stabilisierung gelingen wird - was nur denkbar ist, wenn sie einen großen Teil der Aufständischen einbezieht oder gar von ihnen dominiert wird - oder in einem nächsten Schritt zur erneuten Machtübernahme der Taliban und ihrer Verbündeten führt, ist gegenwärtig nicht prognostizierbar. Es deutet aber alles darauf hin, dass der schon über dreißigjährige Afghanistankrieg nicht durch einen Friedensschluss beendet, sondern sich irgendwann totlaufen wird. Auch ein solches Kriegsende würde schließlich wohl durch Verhandlungen und Abkommen ratifiziert, aber nicht durch solche herbeigeführt. Die gegenwärtige Situation und Zukunftsperspektive Afghanistans wird in einer aktuellen Studie des Strategic Studies Institute des US Army War College so zusammengefaßt: “The prognosis for Afghanistan is far less optimistic (als für Irak; JH). The United States adopted the correct strategy for that war only in 2009, long after the conflict had become a chronic insurgency in which the Taliban fund their operations through the opium trade and exercise shadow governance over much of the country. The conflict has also spread to Pakistan, which has proven to be a most reluctant ally. Under these circumstances, the chances of a clear-cut victory are remote. Even achieving a compromise peace through co-option will be difficult. The United States must consider that it might have to withdraw without a satisfactory resolution to the insurgency. In that case, it will need to engage whoever governs Afghanistan to hold them accountable for terrorism launched from Afghan territory.”
Schriftliche Fassung des Vortrages beim
Quellenangaben in der gedruckten Fassung.
weitere Texte zu Afghanistan hier
Bibliographie Bubna, Mayank: “Afghanistan. Talking to Taliban”, IPCS Issue Brief, No. 94, March 2009. Christia, Fotini/Semple, Michael: „Die Taliban -Versöhnung und Reintegration“, in: Friedensgutachten 2010, Münster, S. 32-48. Dorronsoro, Gilles: “The Taliban’s Winning Strategy in Afghanistan”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington/Moscow/Beijing/Beirut/Brussels, 2009. Foxley, Tim: “The Taliban’s propaganda activities: how well is the Afghan insurgency communicating and what is it saying?”, SIPRI Project Paper, June 2007. Gady, Franz-Stefan: “Negotiating with the Taliban: Lessons from Vietnam”, in: Small Wars Journal, November 2010. Giustozzi, Antonio: “Negotiating with the Taliban. Issues and prospects”, Century Foundation Report, June 2010. Hippler Jochen, Counterinsurgency and Political Control – US Military Strategies Regarding Regional Conflict, INEF-Report 81 (Institute for Development and Peace), Duisburg 2006 Hippler, Jochen , Afghanistan: Kurskorrektur oder Rückzug? - Die politischen Folgen aus der Gewalteskalation, Policy Paper 29 der Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF), Bonn 2008 Hippler, Jochen: „The Decisive Battle is for the People’s Minds“ – Der Wandel des Krieges: Folgerungen für die Friedens-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik; in: Jochen Hippler/Christiane Fröhlich (et al.) Friedensgutachten 2009, Münster, S. 32-47. Hippler, Jochen: „Die neue Afghanistan-Strategie der Regierung Obama“, in: Hippler, Jochen/ Fröhlich, Christiane (et al.), Friedensgutachten 2010, Münster, S. 63-75. International Crisis Group: “Afghanistan. Exit vs Engagement”, Crisis Group Asia, Briefing No. 115, November 2010. International Crisis Group: “Taliban propaganda: Winning the war of words”, Asia Report No. 158, July 2008. Katzman, Kenneth: “Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and US Policy”, CRS Report for Congress, June 2011. Lafraie, Najibullah: “Resurgence of the Taliban insurgency in Afghanistan: How and why?”, in: International Politics, Vol. 46, N0. 1, S. 102-113. Masadykov, Talatbek / Giustozzi, Antonio / Page, James Michael: “Negotiating with the Taliban: Toward a solution for the afghan conflict”, Crisis States Working Papers Series No. 2, Working Paper no. 66, 2010. O’Hanlon, Michael: “Toward Reconciliation in Afghanistan”, in: The Washington Quarterly, Vol. 32, No 2, S. 139-147. Petraeus, David H. General (Interview 25. August 2010): „Reconciliation With Taliban is Ultimate Goal for Afghanistan's Future”, online: www.foxnews.com/politics/2010/08/25/petraeus-reconciliation-taliban-ultimate-goal-afghanistans-future/. Rashid, Ahmed: “Letter from Afghanistan: Are the Taliban Winning?”, in: Current History, No. 20, January 2007. Ruttig, Thomas: “The Ex-Taleban on the High Peace Council. A renewed role for the Khuddam ul-Furqan?”, Afghanistan Analysts Network, 2010. Sajjad, Tazreena: „Peace at all costs? Reintegration and Reconciliation in Afghanistan”, AREU Issues Paper Series No. 1035E, October 2010. Suhrke, Astri [u.a.]: “Conciliatory approaches to the insurgency in Afghanistan: an overview”, CMI Report, 2009. US Army/US Marine Corps, Counterinsurgency Field Manual FM 3-24, Chicago 2007. Waldman, Matt: “Dangerous Liaisons with the Afghan Taliban. The Feasibility and Risks of Negotiations”, USIP Special Report 256, October 2010.
weitere Texte zu Afghanistan hier
|
| [ Home ] [ zur Person ] [ Bücher ] [ Aufsätze ] [ Texts in English ] [ Fotos ] [ Blog ] |