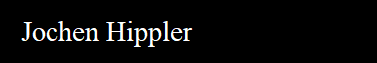

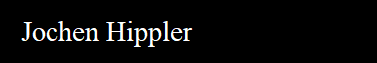 |
 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Jochen Hippler USA und Europa: unterschiedliche Sicherheitspolitiken
In den Jahren 2002 und 2003 kam es zu einer beispiellosen Belastung der europäisch-US-amerikanischen Beziehungen – insbesondere des deutsch-amerikanischen Verhältnisses. Im Zentrum der Auseinandersetzungen standen dabei nicht Fragen der direkten bilateralen Beziehungen (wie z.B. traditionell immer wieder auftretende wirtschaftspolitische Meinungsverschiedenheiten), sondern die Frage der Irakpolitik, insbesondere die Frage der Anwendung militärischer Gewalt. Hinter den Auseinandersetzungen zwischen Berlin und Washington um die Frage eines Krieges gegen den Irak verbargen sich nicht allein unterschiedliche Auffassungen über die Politik gegenüber der ölreichen Region am Persisch-Arabischen Golf, sondern auch sehr verschiedene Sichtweisen möglicher sicherheitspolitischer Bedrohungen aus der Dritten Welt und sich widersprechende sicherheitspolitische Grundansätze und unterschiedliche Einschätzungen der Bedeutung des Völkerrechts und der Vereinten Nationen für die Regelung von Konflikten. Zusammengenommen führten diese Differenzen zu einer massiven Belastung der NATO und der transatlantischen Beziehungen, die anlässlich der Irak-Politik zum Ausdruck kamen. Während die Bundesrepublik – und die meisten anderen westeuropäischen Staaten – ihre Außenpolitik primär als europäische Innenpolitik, in zweiter Linie als Regionalpolitik in bezug auf benachbarte Schlüsselregionen (vor allem Osteuropa und Nordamerika) definieren, betreiben die USA eine global angelegte Politik, die ihre Interessen nicht nur weltweit, sondern auch deutlich umfassender definiert. Konzeptionell bestehen inzwischen krasse Unterschiede in den sicherheitspolitischen Orientierungen auf beiden Seiten des Atlantik – was in der realen Politik trotz der Differenzen über den Irakkrieg allerdings weniger scharf ausgeprägt ist.
In den USA bewertete man die Lage grundlegend anders. Washington definiert seine Außen- und Sicherheitspolitik aus der Perspektive seiner weltpolitischen Rolle, nicht als Regionalmacht. Die USA verfügen im weit größeren Maße als andere Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges über die Option unilateraler Politik – ihre wirtschaftliche, militärische und politisch-kulturelle Dominanz eröffnet für sie Möglichkeiten einseitiger Maßnahmen, die für kleinere oder schwächere Länder nicht bestehen. Die Tendenz zum Unilateralismus ist in den USA nicht neu, tritt in unterschiedlichen historischen Phasen und unter verschiedenen Regierungen sehr unterschiedlich in Erscheinung. Sie war zumindest im 20. Jahrhundert neben dem Multilateralismus eine der beiden Grundströmungen US-amerikanischer Außenpolitik, die immer zugleich und nebeneinander existierten, allerdings in wechselnder Gewichtung die Politik prägten. Unter der Regierung Präsident Bushs hat sich der Hang zum Unilateralismus deutlich verstärkt, Multilateralismus wird zunehmend selektiv eingesetzt, vorzugsweise dann, wenn er den nationalen Zielen der USA dienen kann. „Global Governance“ wird in Washington inzwischen fast als Schimpfwort begriffen. Dabei werden die „nationalen Interessen“ in Washington zugleich weiter und enger definiert als in Europa: weiter, weil sie eben nicht regional, sondern weltweit gelten, weil man auch den Sicherheitsbegriff so breit verwendet, dass er nicht nur die Sicherheit im engeren Sinne, sondern auch die Ökonomie, die Politik und sogar die Kultur, Symbole und Werte der eigenen Gesellschaft umfasst, die nirgendwo in Frage gestellt werden dürfen. Enger werden die eigenen Interessen deshalb definiert, da sie stärker in Gegensatz zu denen anderer Länder gestellt werden, und die Notwendigkeit zur Lösung gemeinsamer, etwa globaler Probleme (etwa im Umweltschutz, bei der internationalen Biowaffenkonvention, dem internationalen Strafgerichtshof, um nur wenige Beispiele zu nennen) sehr oft zugunsten der nationalen Eigeninteressen im engeren Sinne verweigert wird. Bei einer Pressekonferenz erläuterte der Pressesprecher des Weißen Hauses, Ari Fleischer: “There have been a series of issues in which the President is going to demonstrate American leadership on because the President is more interested in doing what is right for America and having America lead the world to good solutions to difficult problems. … The President is going to continue to lead America into our relations around the world on the basis of what is right and what is best for America. … The United States will continue to work, under President Bush, well with our allies and partners around the world. But the President will not shirk from his duties to protect the American people from any international agreements that the President does not think are in America's interest.” Darüber hinaus besteht in Washington seit Ende des Kalten Krieges die Tendenz, die seitdem bestehende globale Hegemonie auszudehnen, vertiefen und möglichst in die Zukunft verlängern zu wollen. Der frühere Nationale Sicherheitsberater, Zbigniew Brzezinski, drückte dies Ende der neunziger Jahre so aus: „Kurz, die Politik der USA muss unverdrossen und ohne Wenn und Aber ein doppeltes Ziel verfolgen: die beherrschende Stellung Amerikas für noch mindestens eine Generation und vorzugsweise länger zu bewahren und einen geopolitischen Rahmen zu schaffen, der die mit sozialen und politischen Veränderungen unvermeidlich einhergehenden Erschütterungen und Belastungen dämpfen und sich zum geopolitischen Zentrum gemeinsamer Verantwortung für eine friedliche Weltherrschaft entwickeln kann.“ Der unilaterale historische Augenblick der US-Dominanz soll gefestigt, perpetuiert und zum eigenen nationalen Nutzen eingesetzt werden – notfalls gegen den Widerstand anderer Akteure. In diesem Zusammenhang geht es Washington auch um die Beseitigung der letzten weißen Flecken auf der Landkarte seiner globalen Hegemonie, um die „Schurkenstaaten“, die niedergerungen werden sollen. Dieser Topos ist seit dem Amtsantritt George W. Bushs immer wieder in großer Schärfe formuliert worden, etwa in der Postulierung einer „Achse des Bösen“. Inzwischen sind zwei der „Schurkenstaaten“ bereits gewaltsam erobert worden – Afghanistan und der Irak – und nach der Kontrolle des Irak gab es neue, massive Drohungen gegen die benachbarten Länder Syrien und Iran. Ein aufschlussreiches Indiz des offensiven sicherheitspolitischen Grundansatzes ist die neue Nationale Sicherheitsstrategie, die Präsident George Bush im September 2002 verkündete. Sie zeichnet die Welt als einen gefährlichen Ort, in der die Sicherheit der USA und ihrer Verbündeten vielfach bedroht wird. Zwar seien die Gefahren des Kalten Krieges überwunden, aber „new deadly challenges have emerged from rogue states and terrorists“. Beide Bedrohungen werden verbunden, indem das Strategiepapier terroristische Gruppen zu Klienten der Schurkenstaaten erklärt. Die Vorwürfe diesen Staaten gegenüber sind breit und umfassend: sie unterstützten den Terrorismus, missachteten das Völkerrecht, unterdrückten ihre eigenen Völker zum Vorteil ihrer Herrscher, strebten nach Massenvernichtungswaffen und „reject basic human values and hate the United States and everything for which it stands“. Insbesondere nach dem 11. September 2001 wurden die „Schurkenstaaten“ und der internationale Terrorismus zu einer gesamtheitlichen Bedrohung durch mögliche ABC-Waffen fusioniert – verdeutlicht durch die Vorwürfe gegen den Irak Saddam Husseins, Massenvernichtungswaffen und entsprechende Forschungsprogramme zu unterhalten und zugleich Al-Qaida und Usama bin Ladin zu unterstützen. Die so konstruierte Bedrohung ließ sich nicht immer durch Beweise oder Belege untermauern, wie gerade im Fall Irak deutlich wurde. Dies hinderte die Bush-Administration allerdings nicht daran, sehr offensive Politiken zu formulieren. „The greater the threat, the greater is the risk of inaction – and the more compelling the case for taking anticipatory action to defend ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy attack. To forestall or prevent such hostile acts by our adversaries, the United States will, if necessary, act preemptively.” Damit wird das Recht auf eine vorbeugende Selbstverteidigung proklamiert, die nicht mehr von einem Angriff zu unterscheiden ist: bisher setzt das Völkerrecht mit gutem Grund einen erfolgten oder unmittelbar bevorstehenden Angriff als die Voraussetzung einer Situation der Selbstverteidigung voraus. Diese Einschränkung erscheint einer nach globaler Dominanz strebenden Supermacht ohne ebenbürtigen Gegner inzwischen als hinderlich. In der Nationalen Sicherheitsstrategie findet sich die erhellende Formulierung, dass die Regierung „anerkennt, dass Angriff unsere beste Verteidigung ist“ („that our best defense is a good offense“). Dieser sicherheitspolitische Geist der Offensive führt Washington fast automatisch dazu, das Völkerrecht und die UNO als eher lästige Fesseln zu betrachten und sich lieber auf die eigene Kraft zu verlassen. Unilaterale Politik wird so betont. „While the United States will constantly strive to enlist the support of the international community, we will not hesitate to act alone, if necessary, to exercise our right of self-defense by acting preemptively ...“ Auch wenn sich dieser Passus der Nationalen Sicherheitsstrategie auf die Frage des Terrorismus bezieht, so gilt sein Prinzip doch allgemein: sich nicht als Teil der internationalen Gemeinschaft zu empfinden und sich in diese und ihr Rechtssystem einzuordnen, sondern – wenn nützlich und möglich – diese für sich zu nutzen („enlist the support“), ansonsten einseitig zu handeln. Dass gewaltsames Vorgehen in der internationalen Politik allerdings an die Existenz einer bestehenden (nicht zukünftig befürchteten) Situation der Selbstverteidigung oder einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats gebunden oder sonst völkerrechtswidrig ist, wird nicht als problematisch betrachtet. Insgesamt beinhaltet die Sicherheitspolitik der USA zwar durchaus nicht allein militärische Dimensionen (so ist eine Aufstockung der Auslands- und Entwicklungshilfe geplant), ist aber doch in Inhalt und Stil stark militärisch und offensiv geprägt. Präsident Bush versprach 2002 den Absolventen der US Militärakademie in West Point „zukünftige Siege“, eine in Europa eher ungewöhnliche Rhetorik, und formulierte die eigene Politik in zugespitzt moralischen, quasi-religiösen Tönen: “There can be no neutrality between justice and cruelty, between the innocent and the guilty. We are in a conflict between good and evil, and America will call evil by its name.”
Aus europäischer Sicht stellen sich die Weltlage und die daraus folgenden sicherheitspolitischen Folgerungen anders dar. Zwar bestehen zwischen europäischen Ländern beträchtliche Unterschiede bezüglich der Sicherheitspolitik und der Beziehungen zu Washington, nicht allein zwischen London und Berlin, sondern auch zwischen Paris und Berlin. Aber die Position der Bundesregierung erscheint doch als besonders geeignet, den europäischen Gegenpol zur US-amerikanischen Sicherheitspolitik besonders auf den Punkt zu bringen. Der damalige Verteidigungsminister Scharping formulierte sechs zentrale Ziele deutscher Sicherheitspolitik, die an einer Stärkung der transatlantischen und der europäischen Zusammenarbeit ansetzten, eine Intensivierung von Kooperationsstrukturen in diesem Raum und in regionalen Konfliktregionen einbezogen und in verstärkten Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und multilaterale Organisationen wie UNO und OSZE mündeten. Diese Zielbestimmung macht bereits deutlich, dass deutsche – und mit gewissen Abstrichen auch europäische – Sicherheitspolitik zuerst auf das eigene (transatlantische und europäische) Umfeld zielt und entschieden multilateral ausgerichtet ist. Zwar sind weitere Ziele ebenfalls präsent, etwa Krisenmanagement in anderen Regionen, bleiben aber von nachgeordneter Wichtigkeit. Im August 2002 – also ein knappes Jahr nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 - erläuterte Scharpings Nachfolger als Verteidigungsminister, Peter Struck, sein sicherheitspolitisches Programm der nächsten vier Jahre. Dabei fasste er es in fünf Punkten zusammen: „Erstens: Deutschland wird auch in den nächsten Jahren einen wichtigen Beitrag zur internationalen Friedenssicherung im multinationalen Verbund mit unseren Verbündeten und Partnern leisten.“ … „Zweitens: Wir haben ein großes Interesse daran, dass die NATO als die zentrale euro-atlantische Sicherheitsorganisation ihren Anpassungsprozess an neue Anforderungen erfolgreich fortführt. Wir werden hierzu unseren Beitrag politisch und militärisch leisten.“ … „Drittens: Wir werden die weitere Stärkung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit allem Nachdruck vorantreiben. … Europa muss handlungsfähiger werden und zu eigenständigen Krisenmanagementoperationen in Abstimmung mit der NATO fähig sein.“ … „Viertens: Wir alle, die neue politische und militärische Führung wie alle militärischen und zivilen Angehörigen der Bundeswehr, werden die begonnene umfassende Transformation der Streitkräfte und ihrer Verwaltung konsequent fortsetzen.“ … „Fünftens: Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, die vorbildliche gesellschaftliche Verankerung der Bundeswehr zu erhalten und weiter zu stärken.“ In dieser Aufzählung ist eine Akzentverschiebung erkennbar: zwar wird immer noch ein hohes Gewicht auf die sicherheitspolitische Kooperation im transatlantischen und europäischen Rahmen gelegt, aber eine aktive Behandlung gewaltsamer Regionalkrisen rückte an die erste Stelle – wenn auch in der zurückhaltenden Form „internationaler Friedenssicherung in multinationalen Verbund mit unseren Verbündeten“.
Als Folge der veränderten Rahmenbedingungen nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die Sicherheitspolitik aus ihrem Korsett eines militärischen Gleichgewichts- und Abschreckungsdenkens gelöst. In Deutschland wie auch anderen Ländern wurde zunehmend erkannt, dass „Sicherheit“ nicht primär militärisch erreicht werden kann, sondern Antworten auf zahlreiche andere Fragen erfordert. Die Bundesregierung spricht in diesem Kontext von den „globalen Herausforderungen“ und nennt unter anderem „die Kluft zwischen Arm und Reich, de(n) Klimawandel, Migration, Terror, Kriminalität und vieles andere“, das auf Europa zurückwirke, sowie „Umweltzerstörung und die Folgen schwindender Lebensgrundlagen, Bevölkerungsexplosion und damit verknüpfte soziale Verwerfungen, Ressourcenverknappung, … der rasante technologische Strukturwandel … und nicht zuletzt die Proliferation biologischer, chemischer und nuklearer Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägermittel“. Im Bericht des Bundesverteidigungsministeriums „Bundeswehr 2002 – Sachstand und Perspektiven“ wird zur Bearbeitung dieser sicherheitsrelevanten Faktoren ein „mehrdimensionale(r) Ansatz aus politischen, wirtschaftlichen, entwicklungspolitischen und sicherheitspolitischen Instrumenten“ gefordert. Staatsekretär Ischinger vom Auswärtigen Amt erläuterte im Jahr 2000 den neuen, erweiterten Sicherheitsbegriff, indem er auf die Ursachen von Gewaltkonflikten verwies: „Verändert haben sich auch die Konfliktursachen. Zwar bleibt die unmittelbare Drohung mit militärischer Gewalt weiterhin zentraler Konfliktbeschleuniger. Hinzu kommen Armut, die in Verbindung mit mangelnder Gleichberechtigung der gesellschaftlichen Gruppen in einem Land (diese findet ihren Ausdruck zumeist in einem ungleichberechtigten Zugang zu politischer Macht) zu einer explosiven Mischung führt; wirtschaftlicher Niedergang; gezieltes Schüren schwelender Unzufriedenheit sowie demagogischer Missbrauch ethnischer, religiöser oder nationalistischer Ideen. Daneben treten im Zeitalter der Globalisierung zunehmend andere Bedrohungspotentiale: Umweltzerstörung und Unterentwicklung, Bevölkerungswachstum und Ressourcenknappheit, Menschenrechtsverletzungen, Terrorismus, Drogen, organisierte Kriminalität und die Proliferation von Waffen, besonders Kleinwaffen; dies alles sind Sicherheitsrisiken, die potentiell in offene Gewaltanwendung münden können.“ Ischinger – und er formulierte damit einen Konsens im Auswärtigen Amt und dem BMVg – fasste anschließend den „erweiterten Sicherheitsbegriff so zusammen: „Der erweiterte Sicherheitsbegriff, von dem ich ausgehe, hat drei zentrale Dimensionen:
Insgesamt trägt der „erweiterte Sicherheitsbegriff“ ein doppeltes Gesicht: einerseits handelt es sich um einen Ansatz, der eine Militarisierung der Sicherheitspolitik vermeiden kann und „Sicherheit“ verstärkt auch um wirtschaftliche, soziale oder ökologische Dimensionen anreichert und so den politischen Realitäten besser gerecht wird. Zugleich aber eröffnet er die Gefahr, anstatt die Sicherheitspolitik zu zivilisieren, eine internationale Strukturpolitik zu militarisieren, indem grundlegend zivile Frage vor allem unter dem Gesichtspunkt der „Sicherheit“ wahrgenommen und so direkt oder indirekt, und nicht immer absichtlich Polizei, Geheimdienste und Militär für Dinge (mit)-zuständig werden können, die bisher weit außerhalb ihres Bereichs lagen. In Deutschland ist dies bisher erst in Ansätzen geschehen, in anderen Ländern (vor allem in den USA) ist die Tendenz weit stärker. Je nach konkreter Ausgestaltung des erweiterten Sicherheitsbegriffs kann dieser deshalb zu einem sinnvollen Instrument der Konfliktbearbeitung und Prävention, der allgemeinen Problemlösung zu internationalen Fragen werden, oder zur Schnittstelle zur US-amerikanischen Sicherheitspolitik, die ja ebenfalls ihren Sicherheitsbegriff deutlich erweitert hat, diese Erweiterung aber imperial ausformt. Die verwandten Begriffe sind zum Teil sehr bedeutungsoffen. So kann „gemeinsame Sicherheit“ offensichtlich auf eine kollektive, umfassende, multilaterale Sicherheitsstruktur (etwa im Rahmen der UNO oder OSZE) oder auf die engere Kooperation mit einzelnen, wichtigen Partnern (etwa den USA oder Frankreich) verweisen – was nicht automatisch vereinbar sein muß. Und „präventive Sicherheit“ kann prinzipiell als die vorbeugende, wirtschaftliche und politische Bearbeitung potentieller Konfliktursachen gedeutet werden, aber im Extremfall natürlich auch das Konzept einer „prä-emptiven Selbstverteidigung“ umfassen, das ja bis an einen Angriffskrieg heranreicht. Hier kommt es also nicht auf die attraktiven Überschriften an, sondern auf deren konkrete Ausgestaltung. Konzeptionell unterscheidet sich die Ausformulierung ihres erweiterten Sicherheitsbegriffs durch die Bundesregierung vom US-amerikanischen, indem sie stärker politische und weniger militärische Akzente setzt und sich eher am Ziel einer Konfliktvermeidung orientiert. Bundesaußenminister Fischer formulierte dies so: „Die Bewältigung der globalen Herausforderungen muss einen erweiterten Sicherheitsbegriff und eine auf die Bearbeitung der Ursachen von Konflikten abzielende umfassende Strategie zu Grunde legen. Sie muss vor allem auf Prävention und nicht nur auf Repression setzen. Dies heißt nichts Geringeres als die Grundlagen einer kooperativen Ordnungspolitik für das 21. Jahrhundert zu entwerfen, einer Politik, die Zonen der Ordnungslosigkeit nicht mehr zulässt, die auf eine Weltordnung zielt, die allen Völkern eine volle und gerechte Teilhabe ermöglicht. Dazu gehört, die ökonomische Globalisierung sozial für mehr Menschen gerechter zu gestalten und durch eine dringend notwendige politische Globalisierung zu ergänzen.“ Fassen wir zusammen: Die Bundesrepublik betrachtet Sicherheitspolitik vorwiegend unter dem Gesichtspunkt, in Europa, angrenzenden Regionen und anderswo Stabilität zu sichern und Gewaltkonflikte zu vermeiden. Dabei betont sie die Notwendigkeit, die Konfliktursachen zu bearbeiten, sie betont die Notwendigkeit von Krisenprävention, sie ordnet Gewaltkonflikte und eine daran orientierte Politik in einen Rahmen globaler und meist nicht-militärischer Faktoren ein, und sie betont immer wieder nachdrücklich die Bedeutung multilateralen Vorgehens und der Vereinten Nationen, wenn man etwa on einer „konsequenten Politik des Interessensausgleichs und des Multilateralismus“ spricht. Außenminister Fischer setzte sich Außenminister Fischer nachdrücklich für Multilateralismus, für eine „kooperative neue Weltordnung“, für starke Vereinte Nationen und eine „multilaterale Weltordnung auf kooperativer Sicherheitsgrundlage“ ein. Solche Formulierungen klingen in Deutschland und weiten Teilen Europas wie Selbstverständlichkeiten. Bezieht man sie aber auf die drastisch unilateralen Positionen der US-Administration der letzten Jahre – durchaus auch bereits vor der Präsidentschaft George W. Bushs – dann wirken Sie eher als konzeptioneller Gegenpol zur US-amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Der Irak-Krieg des März und April 2003 hat diese unterschiedlichen sicherheitspolitischen Herangehensweisen auf beiden Seiten des Atlantiks nur besonders deutlich hervortreten lassen und weiter zugespitzt, aber nicht verursacht. Der Krieg erschwerte es, die unterschiedlichen Politikansätze hinter Formelkompromissen zu verbergen.
Die Tatsache, dass auf beiden Seiten des Atlantiks sehr unterschiedliche sicherheitspolitische Äußerungen formuliert werden, muß nicht automatisch bedeuten, dass die reale Politik in gleichem Maße differiert. Öffentliche und offizielle Stellungnahmen und Konzepte von Regierungen bedeuten nicht, dass diese unbedingt in vollem Ausmaß die Politik leiten. Verbale Verlautbarungen können irreführen, sie können mehr versprechen, als die entsprechende Regierung halten kann; so mögen der innenpolitischen Beruhigung dienen oder aus rein taktischen Gründen erfolgt sein; sie können den Willen einer Regierung formulieren, die nicht über die Mittel zu seiner Umsetzung verfügt oder durch externe Hemmnisse daran gehindert wird; sie mögen nicht so konsequent gemeint sein, wie sie formuliert wurden. Dies gilt für die US-amerikanischen wie die deutschen Erklärungen zur Sicherheitspolitik: Die US-Spitzenpolitiker könnten zur Großsprecherei neigen oder ihre scharfe Rhetorik könnte der Einschüchterung Dritter, und die wohlklingenden Formulierungen der deutschen Regierung könnten zur Beruhigung ihrer rot-grünen Basis dienen. Bezogen auf die Bush-Administration hat spätestens der Irak-Krieg gezeigt, dass diese zwar durchaus mit der Wahrheit in ihrer Außen- und Militärpolitik flexibel umgeht (man denke an die Behauptungen zur Begründung des Krieges, an gefälschte Dokumente und anderes), andererseits die Formulierungen eines unilateralen, von der UNO nicht zu beeindruckenden und prä-emptiven sicherheitspolitischen Konzeptes durchaus ernst gemeint waren und exakt umgesetzt wurden. Bezogen auf die Bundesregierung und andere europäische Länder stellt sich die Situation komplizierter dar.
Die Ambivalenz neuer deutscher – und europäischer – Sicherheitspolitik wird in den Verteidigungspolitischen Richtlinien deutlich, die der Verteidigungsminister im Mai 2003 der Öffentlichkeit vorstellte. Auch in diesem Dokument ist an verschiedenen Stellen von Prävention, einem erweiterten Sicherheitsbegriff und der Notwendigkeit des Multilateralismus die Rede. Allerdings wird der Sicherheitsbegriff zum Teil auf eine eher unklare Art inhaltlich und geographisch ausgeweitet, die viele Fragen aufwirft. In Punkt 5 heißt es etwa: „Verteidigung heute umfasst allerdings mehr als die herkömmliche Verteidigung an den Landesgrenzen gegen einen konventionellen Angriff. Sie schließt die Verhütung von Konflikten und Krisen, die gemeinsame Bewältigung von Krisen und die Krisennachsorge ein. Dementsprechend lässt sich Verteidigung geografisch nicht mehr eingrenzen, sondern trägt zur Wahrung unserer Sicherheit bei, wo immer diese gefährdet ist.“ Danach hat sich die Rolle des Militärs („Verteidigung“ ist ja der entsprechende Euphemismus) ausgedehnt: es geht nicht mehr allein um tatsächliche Verteidigung des eigenen Landes und Bündnisses, sondern um allgemeinen Umgang mit „Krisen“, deren Charakter und Relevanz für die eigene „Sicherheit“ oft ungeklärt bleibt, und der Einsatz von Soldaten zu Kampfzwecken soll auch nicht mehr allein innerhalb des NATO-Geltungsbereiches möglich sein, sondern weltweit „zur Wahrung unserer Sicherheit …, wo immer diese gefährdet ist“. Und Punkt 37 der Richtlinien formuliert ebenso breit die inhaltlichen Einsatzkriterien von Militär: „Gleichwohl sind die politische Bereitschaft und die Fähigkeit, Freiheit und Menschenrechte, Stabilität und Sicherheit notfalls auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen oder wiederherzustellen, unverzichtbare Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit eines umfassenden Ansatzes von Sicherheitspolitik.“ Dabei ist offensichtlich gegen die benutzten Begriffe – Freiheit, Menschenrechte, Stabilität und Sicherheit – als politische Ziele wenig einzuwenden. Allerdings ist das Vorhaben, diese „notfalls“ auch militärisch zu erzwingen, etwas irritierend, da davon im Grundgesetz auch nicht einmal andeutungsweise die Rede ist und insbesondere die beiden letztgenannten Begriffe „Stabilität und Sicherheit“ so breit und unbestimmt sind, dass sie praktisch jede Einsatzform rechtfertigen könnten. Den Sicherheitsbegriff auf diese Art zu „erweitern“ bedeutet, ihn ins Beliebige aufzulösen und eben nicht allein die proklamierten – vernünftigen – Politikziele wie Krisenprävention und humanitäre Hilfe vollziehen zu können, sondern letztlich auch jede Form von Krieg, soweit er nur politisch gewünscht würde. Eine solche Generalöffnung von „Sicherheitspolitik“ könnte sich später als gefährlich erweisen, insbesondere wenn manche Bündnispartner immer wieder massiven Druck ausüben, sich an militärischen Abenteuern zu beteiligen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass eine erkennbare Lücke zwischen den häufig friedenspolitisch konstruktiven Erklärungen und Konzepten einerseits, und einer eher widersprüchlichen militärpolitischen Praxis besteht – die sich allerdings in letzter Zeit zu vermindern scheint, indem die Politikformulierungen sich dieser Praxis annähern.
Gegenwärtig bestehen weiterhin starke konzeptionelle Differenzen und Spannungen zwischen den USA und großen Teilen Europas, was die Wahrnehmung von Risiken und Bedrohungen und die sicherheitspolitischen Antworten betrifft. Diese sind kaum grundsätzlich auflösbar, da sie vor allem aus den sehr unterschiedlichen Machtstellungen beider Seiten in der Weltpolitik resultieren, die durch unterschiedliche politischen Kulturen (etwa einem unbefangeneren Umgang mit Gewalt in den USA) noch ergänzt werden. Vereinfacht gesprochen ergeben sich daraus zwei langfristig (über ein bis zwei Generationen) mögliche Entwicklungsoptionen:
Kurzfristig (also in den nächsten 5-10 Jahren) spricht einiges dafür, daß die konzeptionellen Differenzen beider Seiten durch Formelkompromisse überdeckt werden, die die Grundkonflikte nicht aufheben werden. Außerdem ist absehbar, daß die europäischen Staaten sich in manchen Teilbereichen der Sicherheitspolitik den US-Positionen annähern werden, da sie eine von den USA unabhängige Sicherheitspolitik auf absehbare Zeit nicht werden durchhalten können – aus innen- und außenpolitischen Gründen. Langfristig aber scheint es gegenwärtig am wahrscheinlichsten zu sein, daß keines der beiden Szenarien sich in Reinform wird durchsetzen können, sondern daß es zu einer Mischform kommen wird. Die Distanz dürfte dann wachsen, ohne in der nächsten Generation bereits zu einer sicherheitspolitischen Entkopplung der USA und Europas zu führen, weitere Konflikte und Kompromisse, und eine punktuelle taktische Annäherung Europas an die US-Politik würde die sicherheitspolitischen – und anderen – Beziehungen dann auf einige Jahrzehnte in einem komplexen Schwebezustand halten, bei dem die gemeinsamen Interessen und die erkennbaren Widersprüche kunstvoll austariert werden dürften. Quelle: und wie immer: Copyright beachten!
weitere Texte zu Gewaltkonflikten, Friedens- und Sicherheitspolitik hier
|
| [ Home ] [ zur Person ] [ Bücher ] [ Aufsätze ] [ Texts in English ] [ Fotos ] [ Blog ] |