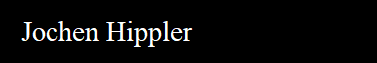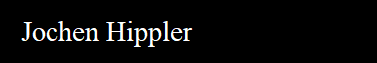|
Jan Hanrath / Jochen Hippler als pdf-Datei
Die U.S.-amerikanische Politik im Nahen und Mittleren Osten
unter Präsident Barack Obama
Zu Beginn seiner Amtszeit als 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sieht sich Barack Obama mit großen Herausforderungen im Nahen und Mittleren Osten konfrontiert. Nach der Eskalation der Gewalt im Gazastreifen scheint eine Lösung des Nahostkonflikts in weiter Ferne, im Irak und in Afghanistan ist das US-Militär nach wie vor in verlustreichen Besatzungssituationen gebunden und das Ansehen der USA ist in der gesamten islamisch geprägten Welt nach den Amtszeiten von George W. Bush schlechter denn je.
Schon während des Präsidentschaftswahlkampfes hatte Obama verkündet, vom ersten Amtstag an auf einen Frieden im Nahen Osten hin zu arbeiten und frischen Wind in die Nah- und Mittelostpolitik zu bringen. Und tatsächlich, kaum 24 Stunden im Amt, telefonierte er bereits mit dem israelischen Premierminister Ehud Olmert, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmud Abbas, dem ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarrak und dem jordanischen König Abdallah. Am darauf folgenden Tag ernannte er den in Krisendiplomatie erprobten Ex-Senator George Mitchell zum neuen Sondergesandten für den Nahen Osten. Ebenso bezeichnend für sein Interesse an der Region und seinen Willen, die Beziehungen der USA zu der islamisch geprägten Welt in eine neue Richtung zu bewegen, war sein erstes größeres Interview als Präsident, das er dem arabischen Fernsehsender Al-Arabiya gab. So deutet einiges darauf hin, dass der neue Präsident dem Entwurf einer eigenen, tragfähigen Agenda für den Nahen und Mittleren Osten besondere Bedeutung beimisst. Dies ist alles andere als selbstverständlich, da frühere Präsidenten dem Nahostkonflikt am Beginn ihrer Amtszeiten meist auswichen und erst gegen Ende entsprechende Initiativen einleiteten – meist zu spät, um vor dem Ausscheiden aus dem Amt noch Wirkung zu erzielen.
Ähnlich wie auch in der US-amerikanischen Innenpolitik, wo die Erwartungen an Obama ins Messianische stiegen, nährten diese Zeichen nicht zuletzt auch im Nahen und Mittleren Osten Hoffnungen, dass mit dem neuen Präsidenten auch eine neue Ära des Engagements der USA in der Region anbricht. Tatsächlich hat jedoch die Vergangenheit gezeigt, dass sich Änderungen in der US-amerikanischen Nahostpolitik nicht plötzlich, sondern nur langsam und graduell entwickeln. Dabei ist eine Vielzahl mitunter rivalisierender Interessen innerhalb der Bürokratie, der Wirtschaftseliten, dem Militär, dem Kongress und verschiedenster Lobbies von Bedeutung. Im Folgenden werden deshalb zunächst die historische Entwicklung der Nah- und Mittelostpolitik sowie die strategischen Grundinteressen der USA in der Region beleuchtet, um im Anschluss die Herausforderungen in einzelnen Konfliktherden sowie die ersten Schritte der Obama-Administration zu analysieren.
Die USA im Nahen und Mittleren Osten
Die aktive Politik und dominierende Rolle der USA im Nahen und Mittleren Osten ist historisch noch relativ jung. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Großbritannien dank seiner kolonialen Vergangenheit und militärischen Präsenz die Region dominieren, zog sich jedoch aufgrund seiner verminderten weltpolitischen Bedeutung nach und nach zurück. In diese Lücke stießen zunehmend die USA. Dabei konzentrierte sich deren Einflussnahme anfangs fast ausschließlich auf zwei Schlüsselstaaten der Region, den Iran und Saudi-Arabien. Trotz der Reduzierung westlicher Militärpräsenz nach dem britischen Rückzug hielten es die USA zunächst nicht für nötig, ihr eigenes offenes Engagement zu vergrößern.
Die Jahre 1979/80 wurden aufgrund dreier Entwicklungen zum Wendepunkt der US-Nah- und Mittelostpolitik: Trotz der zuvor massiven militärischen Aufrüstung der beiden Stellvertreter am Golf, Iran und Saudi Arabien, brach 1979 die Zwei-Säulen-Politik mit der islamischen Revolution im Iran zusammen. Saudi Arabien war nicht in der Lage, die alte Rolle des Iran mit zu übernehmen, ohne sich selbst zu destabilisieren. Die sowjetische Militärintervention in Afghanistan wurde in Washington als Vordringen Moskaus in Richtung Persischer Golf und zu den dortigen Ölvorkommen interpretiert. Und als dann der Irak den nunmehr scharf antiamerikanischen Iran im September 1980 (wenn auch mit US-amerikanischer Sympathie und Unterstützung) überfiel, schien die Phase US-kontrollierter Stabilität am Golf erst einmal vorbei.
Als Folge dieser Entwicklungen verkündete Präsident Carter, dass die USA nun jeden Versuch „äußerer Mächte", die Golfregion zu kontrollieren, „als Angriff auf ihre vitalen Interessen“ verstehen und mit allen, auch militärischen, Mitteln zurückweisen würden. Nachdem die Bemühungen scheiterten, alle konservativen und westlich ausgerichteten Staaten der Region (einschließlich Israel) gemeinsam gegen die „sowjetische Bedrohung“ in einem „strategischen Konsens“ zu organisieren, reagierte die US-Regierung mit einem problematischen policy mix: einerseits verkündete sie eine neue „strategische Allianz“, die nun allerdings nur die USA und Israel verbinden sollte. Damit wurden jedoch die Beziehungen der USA zu jenen arabischen Staaten wie Jordanien, Ägypten oder Saudi-Arabien nicht eben erleichtert, um deren Zusammenarbeit und Unterstützung man sich andererseits ebenfalls bemühte.
In den folgenden Jahren unternahm Washington beträchtliche Anstrengungen, die praktischen Voraussetzungen für eine aktive, militärisch ausgerichtete Politik in der Region zu schaffen. Beispielsweise wurde das Regionalkommando US-CENTCOM (US Central Command) mit Zuständigkeit für die Länder des Nahen und Mittleren Ostens, Ostafrika und Zentralasien installiert, das heute über Stützpunkte in Kuwait, Bahrain, Qatar, den Vereinten Arabischen Emiraten, dem Oman, Pakistan und in Djibouti verfügt. Hinzu kommen unterschiedliche Formen militärischer Kooperation mit der Türkei, Israel, Ägypten, Saudi-Arabien und anderen Ländern. Nicht zuletzt diese ständige und umfassende militärische Präsenz macht deutlich, dass die früher geringe Aufmerksamkeit Washingtons für die Region sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt hatte.
Strategische Grundinteressen der USA im Nahen und Mittleren Osten
Die Politik Washingtons im Nahen und Mittleren Osten wird – vor allem in den letzten Jahren – häufig mit moralischen und wertegestützten Argumenten begründet („Freiheit“, „Demokratie“), beruht aber tatsächlich auf drei Kerninteressen:
-der zum großen Teil innenpolitisch naheliegenden Unterstützung Israels,
-der Wahrung der Stabilität US-freundlicher Regime und entsprechender regionaler Stabilität, was sich früher in einer Politik der Schwächung der regionalen Rolle der Sowjetunion äußerte, heute die Sicherung befreundeter Regime und die Konfrontation vorgeblicher „Schurkenstaaten“ einschließt;
-und den strategischen Interessen einer Kontrolle der energiepolitischen Schlüsselregion des Persischen Golfes, wobei sich der Fokus inzwischen auch auf die energiereichen Regionen am Kaspischen Meer und in Zentralasien erweiterte.
Diese drei Interessendimensionen ergänzen sich nicht automatisch, sondern können durchaus in Widersprüche zueinander geraten: So kann sich die grundsätzliche Unterstützung Israels zwar zugleich auf breite innenpolitische Unterstützung (inzwischen nicht nur seitens jüdischer Interessengruppen, sondern auch aus Kreisen fundamentalistischer Christen, die der Republikanischen Partei nahe stehen, etwa der Strömung der „Christlichen Zionisten“ ) und eine teilweise ideologische Nähe zur israelischen Politik stützen (etwa deren anti-iranische und anti-syrische Tendenz), untergräbt aber häufig die regionale Stabilität, wenn Washington z.B. die israelische Besatzungspolitik in Palästina oder den Krieg gegen den Libanon (2006) faktisch unterstützt. Eine solche Politik kann auch weiter entfernte, pro-amerikanische arabische Regime in Schwierigkeiten bringen, die dadurch bei der eigenen Bevölkerung diskreditiert werden. Die prinzipielle Positionierung an der Seite Israels macht auch die Politik zur Kontrolle der Ölregion am Persischen Golf nicht eben leichter.
Das US-Interesse an Ölimporten hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht. Standen beispielsweise einem US-Verbrauch von 14,7 Millionen barrel (ein Fass von 159 Liter) pro Tag im Jahr 1970 noch 11,7 Millionen barrel eigener Ölproduktion gegenüber (die USA produzierten also fast 80 Prozent des eigenen Ölbedarfs), so hatte sich dies bis zur Jahrtausendwende entscheidend geändert. 2000 verbrauchten die USA 19,7 Millionen, förderten aber nur noch 9,1 Millionen barrel pro Tag, also etwas mehr als 46 Prozent des Eigenbedarfs. In dieser Zeit ging der Anteil der USA an der Welt-Ölproduktion von 23,9 auf 11,8 Prozent zurück, während der am weltweiten Verbrauch nur von 31,4 auf 26 Prozent sank. Zugleich drängten andere Länder massiv auf den Energiemarkt: China verbrauchte 2004 fast die dreifache Menge Öl wie 1990 und damit schon zweieinhalb Mal so viel wie Deutschland. Die USA decken zwar gegenwärtig ihren eigenen Importbedarf nur zum kleineren Teil im Nahen und Mittleren Osten. Ihre wichtigsten Lieferanten für Rohöl sind Kanada (rund 2 Mio. barrel pro Tag), Saudi Arabien (knapp 1,4 Mio. barrel), Mexiko (1,1 Mio.), Venezuela (1,0), Nigeria (0,9), Angola (0,6) und der Irak (gut 0,5 Mio.); alle Zahlen von Dezember 2008.
Nun darf aus dieser geographischen Verteilung allerdings nicht geschlossen werden, dass die USA vom Öl des Persischen Golfs und der erwarteten Vorkommen in Zentralasien unabhängig wären – der Ölmarkt ist global, und bei einer Situation teilweise bereits sinkender Fördermengen und weiter deutlich wachsender Nachfrage (gerade durch China und andere asiatische Länder) werden der Golf und Zentralasien an wirtschaftsstrategischer Bedeutung eher noch zunehmen. Ein Blick auf die nachgewiesenen Ölreserven der Welt unterstreicht dies noch. Von den sechs Ländern mit den größten Ölreserven liegen fünf am Persischen Golf, nämlich Saudi Arabien (nachgewiesene Ölreserven von 266 Mrd. barrel, fast 20 Prozent der Weltreserven), Iran (136 Mrd. barrel; 10 Prozent der weltweiten Ölvorkommen), Irak (115), Kuwait (104), und Vereinigte Arabische Emirate (98; zusammen weitere fast 24 Prozent der Weltölvorkommen). Nehmen wir noch Katar (15 Mrd. barrel), den Oman (6) und die nicht direkt am Golf gelegenen Länder hinzu (Libyen: 43; Kasachstan: 30; Algerien: 12; Jemen: 3) , dann ergibt sich bereits heute die überragende Bedeutung des Nahen und Mittleren Ostens für die Weltenergieversorgung. Bedacht werden muss dabei auch, dass in einer Reihe dieser Länder auch Erdgas in großer Menge vorhanden ist. Einer Supermacht wie den USA, die darüber hinaus zunehmend von Ölimporten abhängig wird, kann eine solche Region deshalb nicht gleichgültig sein.
Jedoch geht es bei der Politik der US-Administration gegenüber dem Golf zwar um Öl – aber nicht darum, den Fluss des Öls physisch bzw. direkt militärisch zu sichern. Das ist kaum nötig, da das Öl der Region ja zum Verkauf ansteht: Alle Länder müssen es aus wirtschaftlichen Gründen exportieren, dazu zwingen braucht man sie nicht. Es geht auch kaum jemals um die militärische Senkung der Ölpreise – das wird von Politikplanern in Washington gelegentlich als Ziel formuliert, ist aber durch militärische Dominanzpolitik oder Krieg kaum zu erreichen. Im Gegenteil haben militärische Auseinandersetzungen häufig zu einer Preissteigerung geführt oder diese zumindest nicht verhindert. Das US-Interesse am Persischen Golf basiert auf seinem Energiereichtum, auf seiner Bedeutung für die Weltwirtschaft durch die Ölvorkommen, aber eben nicht auf eine direkte und ungebrochene Art und Weise, sondern politisch vermittelt. Das Politikziel besteht weder in der physischen Eroberung des Öls noch in einer direkten Marktregulierung (im Sinne einer erzwungenen Preissenkung) durch Krieg, sondern in der Verweigerung von Vormachtstellung am Golf durch irgendeine nicht befreundete Macht. Das beste Mittel, fremden Einfluss oder gar Vorherrschaft dauerhaft zu verhindern ist, die Region selbst politisch und militärisch zu dominieren.
In diesen Zusammenhang geostrategischer Machtpolitik sollte auch der „Krieg gegen den Terrorismus“ eingeordnet werden. Die Anschläge des 11. September 2001 änderten die Wahrnehmung der eigenen Sicherheit in der amerikanischen Bevölkerung und der Regierung, die diesen Terroranschlag nicht allein als kriminellen Gewaltakt, sondern als Angriff auf die globale US-Hegemonie begriff. Zum ersten Mal waren außenpolitische Konflikte in diesem Maße in die USA hineingetragen worden, waren gerade die Symbole amerikanischer Macht in den USA selbst zum Ziel eines Angriffs gemacht worden: das World Trade Center als Symbol der wirtschaftlichen, das Pentagon als Symbol der militärischen, und das Weiße Haus (Ziel eines weiteren, vorher abgestürzten Flugzeugs) als Symbol der politischen Macht. Auch deshalb ging die Reaktion der US-Regierung über bloße Terrorbekämpfung weit hinaus.
Die Dominanz der Terrorbekämpfung in der Außenpolitik der Bush-Administration speiste sich aus vier Quellen: einmal ging es tatsächlich um die Bekämpfung des Terrorismus, was nicht nur vernünftig, sondern auch innenpolitisch notwendig war. Keine US-Regierung hätte es sich leisten können, „weich“ oder gleichgültig auf die Anschläge des September 2001 zu reagieren. Zweitens zielte die neue Politik auf die Neuordnung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens. Dazu gehörte aus Sicht Washingtons auch der Sturz unliebsamer Regierungen („Schurkenstaaten“), die zu Recht oder zu Unrecht mit dem Terrorismus in Verbindung gebracht wurden. Hier verbanden sich die Regionalinteressen der einzigen Weltmacht mit dem Ziel der Terrorbekämpfung, etwa durch die Unterordnung letzterer unter die Regionalstrategie, oder durch die Legitimierung regionaler Machtpolitik als Terrorbekämpfung. Drittens wurde der Topos der Terrorbekämpfung mit anderen Politikzielen der US-Regierung verknüpft, etwa der Verweigerung von Massenvernichtungswaffen an außenpolitische Gegner. Und schließlich bildete der Anti-Terror-Kampf ein Mittel, die eigene globale Führungsrolle zu zementieren, auch wenn dieser Aspekt seit dem Irakkrieg etwas in den Hintergrund trat.
Ähnlichen Zwecken diente die US-Politik einer Förderung der Demokratie im Nahen und Mittleren Osten, die – neben der Terrorismusbekämpfung und den angeblich existierenden Massenvernichtungswaffen – ebenfalls zur Begründung des Krieges im Irak herangezogen, aber vor allem nach Kriegsende auch zur Rechtfertigung der Afghanistan-Intervention verwendet wurde. Nun ist unbestreitbar, dass der Kampf gegen den Terrorismus – soweit er sich gegen die USA und ihre Verbündeten richtet – tatsächlich ein dringendes Anliegen der US-Regierung ist, so wie man auch annehmen kann, dass sie prinzipiell demokratische Regierungsformen positiver bewertet als diktatorische, zumindest solange jene marktwirtschaftlich orientiert sind und den US-Interessen nicht entgegenstehen. Ein Blick in die Geschichte zeigt als ein wiederkehrendes Element der US-amerikanischen Außenpolitik, dass Demokratie und Rechtstaatlichkeit jedoch nur dann akzeptabel sind, wenn sie ihren strategischen und ökonomischen Zielen nicht entgegenlaufen.
Demokratieförderung unter Präsident Obama
Während seiner Amtszeit betonte Präsident Bush zwar immer wieder die Bedeutung von Demokratieförderung, gleichzeitig ruinierte er durch sein tatsächliches Handeln ihre Legitimität, sodass sie im Wesentlichen als Deckmantel für einen aggressiven US-amerikanischen Unilateralismus wahrgenommen wurde. Die Dominanz der Terrorismusbekämpfung und das Streben nach politischer Stabilität im Nahen und Mittleren Osten führte im Gegenteil zu einem Ausbau der Kooperation mit autoritären Regimen der Region wie z.B. mit Ägypten, Saudi-Arabien oder Pakistan unter General und Präsident Musharraf. Die martialische Rhetorik der Bush-Administration im War on Terror richtete sich vor allem an ein heimisches Publikum und ignorierte dabei weitgehend ihre Wirkung im Rest der Welt, vor allem in islamisch geprägten Ländern. Dies ist eine schwere Hypothek, der sich der neue US-Präsident Obama stellen muss.
Barack Obama hat erste Schritte unternommen, um sich von diesem Erbe zu lösen und signalisierte kaum im Amt, dass ihm an einer Erneuerung der US-amerikanischen Demokratie und der demokratischen Ideale gelegen ist. Wie bereits in seinem Wahlkampf versprochen, kündigte er die Schließung des Gefangenenlagers in Guantanamo binnen Jahresfrist und die Beendigung von Folterpraktiken wie z.B. dem sogenannten water boarding, bei dem das Ertrinken des Opfers simuliert wird, an.
So wichtig diese Maßnahmen waren, so können sie doch nur ein erster Schritt in Richtung einer umfassenden Neuformulierung der US-amerikanischen Demokratisierungsagenda sein. Erste Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass die Obama-Administration der Demokratieförderung in Zukunft einen weniger prominenten Stellenwert einräumen und sich vermehrt anderen Kerninteressen ihrer Außenpolitik widmen möchte. Weder im Wahlkampf noch als Präsident hat sich Barack Obama eindeutig dazu geäußert. Die internationalen Herausforderungen, mit denen er sich zu Beginn seiner Amtszeit konfrontiert sieht, angefangen von der internationalen Wirtschaftskrise bis hin zu den weiter unten thematisierten Konfliktherden im Nahen und Mittleren Osten, müssen trotzdem nicht zwangsläufig zu einer Orientierung seiner Nah- und Mittelostpolitik an der Realistischen Schule der Internationalen Beziehungen führen. Vielmehr bieten die Kernstücke Obamas gesamter politischer Philosophie eine natürliche Basis für einen neuen Rahmen im Feld der Demokratieförderung.
In dieselbe Richtung gehen die Empfehlungen von über 140 Wissenschaftlern, Experten und Journalisten in einem offenen Brief an den Präsidenten im März 2009. Sie fordern im Interesse der USA und einer langfristigen Stabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens die eindeutige Unterstützung demokratischer Bewegungen unter Einbeziehung moderater Islamisten sowie eine harte Haltung gegenüber autoritären Regimen in der Region.
Um glaubhaft gegenüber den Regierungen und Bevölkerungen im Nahen und Mittleren Osten und handlungsfähig in den regionalen Konflikten zu sein, wird es in entscheidendem Maße auf den Stil der US-Außenpolitik sowie auf eine Trennung einer Demokratieförderung von Konzepten des regime change und der Terrorismusbekämpfung ankommen.
Der Nahostkonflikt
Es scheint ein notwendiges Übel für alle US-Präsidenten der vergangenen Jahrzehnte zu sein, sich früher oder später dem Nahostkonflikt widmen zu müssen. Das Scheitern des von Präsident Bush initiierten Annapolis-Prozesses und die Gewalteskalation durch das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen ließen den neuen US-Präsidenten schon zu Beginn seiner Amtszeit diesen Dauerkonflikt ganz oben auf die Prioritätenliste setzen.
Die Aussichten für eine umfassende Lösung des Nahostkonfliktes stellen sich für Präsident Obama jedoch schwierig dar. Nicht die zuletzt die Fehlentscheidungen der vorherigen US-Regierung haben zu einer Schwächung der moderaten Kräfte sowohl auf israelischer als auch palästinensischer Seite beigetragen. Nach den israelischen Parlamentswahlen im Februar 2009 deutet alles auf das Zustandekommen einer rechtsgerichteten Regierung unter der Führung von Benjamin Netanjahu hin, der eine Zwei-Staaten-Lösung bis auf weiteres ablehnt und bereits im Wahlkampf ein hartes Vorgehen gegen die Palästinenser angekündigt hatte. Aller Voraussicht nach wird der ultranationalistische Koalitionspartner Israel Beitenu mit Avigdor Liebermann den Außenminister stellen. Das palästinensische Lager ist zwischen der Fatah von Präsident Mahmud Abbas und der Hamas völlig zerstritten und die Palästinensische Autonomiebehörde derzeit weitgehend handlungsunfähig. Der andauernde Aus- und Neubau israelischer Siedlungen im Westjordanland und das militärische Vorgehen Israels gegen die Hamas im Gazastreifen, von wo aus diese immer wieder mit selbstgebauten Raketen israelische Siedlungen unter Beschuss genommen hatte, sowie das aus diesem Krieg resultierende massive Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung, haben die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konfliktes ebenfalls nicht verbessert.
Die ersten Schritte des neuen US-Präsidenten deuten darauf hin, dass er bereit ist andere Politikoptionen als seine Vorgängerregierung zu verfolgen, auch wenn von einem völligen Richtungswechsel nicht die Rede sein kann. Vor allem signalisiert Obama Bereitschaft auch Akteure mit einzubeziehen, deren Anerkennung bislang ausgeschlossen war. Die bisherige US-Nahostpolitik zeichnete sich durch eine weitgehende Unterstützung israelischer Positionen aus. Dies ist nicht zuletzt auch der US-amerikanischen öffentlichen Meinung, die sich traditionell Israel verbunden fühlt, und einer starken pro-israelischen Lobby in den USA mit hohem Mobilisierungspotential geschuldet. Dies hat der Glaubwürdigkeit der USA als ehrlichem Makler im Nahostkonflikt immer wieder schweren Schaden zugefügt. Um in Zukunft Glaubwürdigkeit und damit auch Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, wird die neue US-Regierung den Interessen und Sorgen der Palästinenser mehr Aufmerksamkeit schenken und diese ins Zentrum ihrer Friedensbemühungen stellen müssen. Dies gilt sowohl für die politische Führung der Palästinenser als auch für die palästinensische Öffentlichkeit. Diese Rücksichtnahme und Einbeziehung der palästinensischen Interessen bedeutet jedoch nicht deren Bevorzugung gegenüber israelischen Positionen. Im Gegenteil: nur auf diese Weise lassen sich langfristig auch die israelischen Interessen, bei denen sicherheitspolitische Überlegungen im Mittelpunkt stehen, verwirklichen. Solange nicht auch die Palästinenser in ausreichendem Maße ihre Forderungen berücksichtigt sehen, werden auch die Israelis nicht der von ihnen gewünschten Sicherheit näher kommen.
Ein wichtiger Schritt wäre die deutliche Verurteilung der israelischen Siedlungsaktivitäten im Westjordanland, die einen klaren Verstoß gegen internationales Recht darstellen und entsprechende UN-Resolutionen verletzen. Bislang wurde das Vorgehen Israels von den USA wenn auch nicht offiziell unterstützt, so doch im Wesentlichen toleriert. Die Zurückhaltung von Außenministerin Hillary Clinton in diesem Punkt und die äußerst vorsichtige Kritik an der Zerstörung palästinensischer Wohnhäuser bei ihrem ersten offiziellen Besuch in Israel deuten eher auf Kontinuität hin.
Weitere Voraussetzung für die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung, die nach wie vor ausdrücklich von der US-Regierung angestrebt wird, und für ein Ende palästinensischer Angriffe auf Israel ist die Umsetzung der 2005 noch von Clintons Vorgängerin Condoleezza Rice verhandelten Vereinbarung über den freien Zugang für Personen und Waren zum Gazastreifen. Zudem muss auf eine Vereinbarung hinsichtlich einer neuen Machtverteilung zwischen Fatah und Hamas hingearbeitet werden.
Im Umgang mit der Hamas muss diese als Realität und Macht anerkannt werden, an der vor allem im Gazastreifen kein Weg vorbei führt. Auch wenn es Israel im Gazakrieg teilweise gelungen ist, Führungskader der Hamas zu töten und deren Infrastruktur zu beschädigen, bleibt die Hamas politisch relevant und in der palästinensischen Bevölkerung tief verwurzelt. Zwar ist die Zustimmung zur Hamas in der letzten Zeit auch unter den Palästinensern gesunken. Als Sieger der Wahlen von 2006 verfügt sie jedoch über eine Mehrheit im – wenn auch zurzeit handlungsunfähigen – Parlament und hält die Kontrolle über die Verwaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) in Gaza. Dies wird in besonderem Maße bei den Überlegungen der internationalen Gemeinschaft zum Wiederaufbau und zur Verteilung humanitärer Hilfen im Gazastreifen deutlich. Falls diese Hilfe durch offizielle Kanäle der PA gehen soll, dann sind diese dort der Hamas unterstellt. Und selbst wenn der Wiederaufbau und die humanitäre Hilfe von internationalen Akteuren übernommen werden sollen, könnten diese nicht ohne die Genehmigung und die Kooperation mit der Hamas-kontrollierten PA in Gaza agieren.
Bislang lautete die offizielle Position der US-Regierung, dass die Hamas solange kein Gesprächs- oder Kooperationspartner sein könne, wie sie nicht das Existenzrecht Israels anerkennt, ihren bewaffneten Widerstand beendet und alle in der Vergangenheit von den Palästinensern unterzeichneten Abkommen anerkennt. Auf ihrer ersten Nahostreise unterstrich Außenministerin Hillary Clinton erneut diese Position. Erste Anzeichen eines vorsichtigen Abrückens von dieser Position lassen sich jedoch erkennen. So treten die USA den Bemühungen der PA und der Hamas nicht entgegen, eine Einheitsregierung zu bilden, und hochrangige US-Offizielle ließen verlauten, im Falle des Zustandekommens einer solchen Regierung die Zusammenarbeit in „irgendeiner Form“ nicht auszuschließen. Ebenso wenig stellt sich die Obama-Administration gegen die Verhandlungen Israels mit der Hamas über einzelne Streitpunkte wie ein Waffenstillstandsabkommen, die Bedingungen eines israelischen Truppenabzugs oder die Frage der Grenzkontrollen.
Es scheint, dass die US-Regierung allmählich aus den Fehlern der Vergangenheit lernt und ihre Gesprächsbereitschaft nicht ausschließlich auf den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und die von ihm geführte Fatah beschränkt. Die häufig favorisierte Strategie „West Bank First“, nach der sich das Problem mit der Hamas im Gazastreifen quasi von alleine lösen würde, wenn es im Westjordanland unter Fatah-Führung zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, einer stabilen Sicherheitslage und einer guten und verantwortlichen Regierungsführung kommt, hat nicht funktioniert. Weder sind in der West Bank substantielle Fortschritte zu sehen – im Gegenteil hat sich die Situation unter all den genannten Aspekten im Vergleich zu den 1990er Jahren verschlechtert –, noch war die Hamas bereit die Rolle des stillen Zuschauers zu spielen, der hilflos seinem Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit zusieht. Stattdessen hat sie sich in Gaza weiter etabliert und die militärische Konfrontation gesucht.
Eine Schlüsselrolle für eine umfassende Bearbeitung des Nahostkonflikts werden in Zukunft die Beziehungen der USA zum israelischen Nachbarn Syrien spielen. Hier deutet sich ein deutlicher Bruch im Vorgehen der Obama-Administration mit dem der Bush-Regierung an. Setzte die Bush-Regierung noch auf eine Isolation des Landes, so schickte Präsident Obama zwei hochrangige US-Beamte nach Damaskus um die Möglichkeiten einer Beendigung der politischen Eiszeit zwischen den beiden Staaten auszuloten. Die USA sind seit der sogenannten Zedernrevolution im Libanon, die sich 2005 an die Ermordung des syrienkritischen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik al-Hariri anschloss, nicht mehr mit einem Botschafter in Damaskus vertreten. Der syrischen Regierung wurde damals vorgeworfen, als Drahtzieher hinter dem Attentat zu stehen. Tatsächlich sind die Aussichten, die indirekten Gespräche zwischen Syrien und Israel, die 2008 von der Türkei vermittelt wurden, als direkte Gespräche unter der Schirmherrschaft der USA fortzuführen, vielversprechender als die derzeitigen Aussichten für einen Frieden zwischen Israel und Palästinensern. Die syrische Regierung ist ernsthaft an einem Frieden interessiert, um durch die Befreiung aus der Isolation die syrische Wirtschaft anzuregen und die Popularität Präsident Bashar al-Assads zu steigern. Voraussetzung für einen Friedensvertrag dürfte die Rückgabe der von Israel 1967 besetzten Golanhöhen sein. Ein syrisch-israelischer Frieden würde sich jedoch positiv auf die gesamte Region auswirken und durch Syriens Einfluss auf die libanesische Hisbollah auch eine dauerhafte Befriedung der israelisch-libanesischen Grenze erleichtern.
Iran
Auch auf den Iran ist Präsident Obama bereits einen deutlichen Schritt zugegangen und hat somit seine im Wahlkampf gemachten Ankündigungen, grundsätzlich auch gegenüber der iranischen Regierung Gesprächsbereitschaft zu zeigen, umgesetzt. Am 20. März, zum iranischen Neujahrsfest Norouz, übermittelte er eine Videobotschaft aus dem Weißen Haus an das iranische Volk und dessen politische Führung, in der er zum Feiertag gratulierte, seinen großen Respekt vor der iranischen Kultur bezeugte und die Wichtigkeit eines Dialogs betonte. Indem er sich so ausdrücklich auch an Präsident Mahmud Ahmadinejad richtete, erkannte er ihn de facto als Gesprächspartner an. Dies kann nach 30-jähriger gegenseitiger Dämonisierung und der Verortung der Islamischen Republik Iran auf der „Achse des Bösen“ durch die Bush-Administration durchaus als historisch angesehen werden. Bereits rund zwei Wochen zuvor hatte schon Außenministerin Clinton erste Signale in Richtung einer Öffnung gegenüber der Führung in Teheran gesendet, als sie sich für eine Teilnahme des Irans an einer hochrangigen Konferenz zur Zukunft Afghanistans Ende März 2009 unter der Schirmherrschaft der USA aussprach.
Diese Einladung resultiert nicht zuletzt aus der Erkenntnis, dass sich die Interessen der USA und des Irans in der Region durchaus überschneiden. In Afghanistan ist beiden Staaten an einer Bekämpfung der Taliban und anderer sunnitischer Extremisten gelegen. Und obwohl der Iran seinen Einfluss im Irak als Druckmittel gegenüber den USA nutzt, ist auch der Regierung in Teheran nicht an einer völligen Destabilisierung und Chaos im Nachbarland – mit möglicherweise negativen Auswirkungen auf die eigene Stabilität – gelegen.
Noch ist es verfrüht Prognosen über die zukünftigen Beziehungen zwischen den USA und dem Iran anzustellen, da vieles auch von den iranischen Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 abhängt. Unabhängig davon, ob sich dort erneut der Hardliner Ahmadinejad oder ein Vertreter des Reformlagers durchsetzt, werden einige Faktoren weiter von Bedeutung sein. Der Iran ist aus dem Krieg der USA gegen den Irak und dem Zusammenbruch des Regimes von Saddam Hussein gestärkt hervorgegangen und hat seine strategische Bedeutung am Persischen Golf ausgebaut. Diese Tatsache müssen auch die USA anerkennen. Es liegt im Interesse keiner der beiden Staaten eine militärische Konfrontation zu suchen. Im Verhältnis zueinander spielen legitime Sicherheitsüberlegungen eine zentrale Rolle. So geht es den USA vor allem darum zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt, sowie um die Beendigung dessen Unterstützung des internationalen Terrorismus. Auf Seiten des Irans geht es um seine territoriale Integrität und die Sicherheit des politischen Regimes. Allein die USA sind derzeit dazu in der Lage, den sicherheitspolitischen Sorgen des Irans Rechnung zu tragen. „Solange das Regime überzeugt ist, dass es sich auf der Zielscheibe amerikanischer Politik befindet und nicht als legitimer Akteur akzeptiert wird, werden seine Mitglieder gerade in der Nuklearfrage nicht die Entscheidungen treffen, die notwendig wären, um wieder Vertrauen bei der internationalen Gemeinschaft aufzubauen.“ Um den Iran zu einer umfassenden Vereinbarung zu bewegen sollten die USA der iranischen Führung ein Angebot machen, das ein Ende des Wirtschaftsembargos beinhaltet sowie die Freigabe eingefrorener iranischer Guthaben, die Wiederherstellung vollständiger diplomatischer Beziehungen, die Unterstützung iranischer Bemühungen der WTO beizutreten und die Förderung ausländischer Direktinvestitionen im Iran. Im Gegenzug müsste die iranische Regierung einer Aussetzung ihres militärisch nutzbaren Atomprogramms, inklusive der Anreicherung von waffenfähigem Plutonium, und einem internationalem Kontrollregime unter der Leitung der Internationalen Atomenergiebehörde zustimmen sowie die Unterstützung von terroristischen Gruppierungen und Aktivitäten beenden und grundsätzliche Menschenrechtsprinzipien im Rahmen internationaler Abkommen anerkennen. Verhandlungen zu einer solchen Vereinbarung sollten ohne umfangreiche Vorbedingungen beginnen. Indem Obama die militärische Karte zurückgezogen hat, ist er den ersten Schritt in diese Richtung gegangen. Eine Koordinierung in Bereichen, in denen sich die Interessen der USA und des Irans überschneiden, bietet die Möglichkeit einer weiteren Annäherung.
Irak – Afghanistan – Pakistan
Ein weiteres Problemfeld für die Obama-Administration wird auf absehbare Zeit die Situation im Irak bleiben. Im Präsidentschaftswahlkampf hatte der spätere Präsident seinen Vorgänger und den Gegenkandidaten McCain immer wieder für ihre Irak-Politik kritisiert. Es werde der „falsche Krieg“ geführt: Der dringliche Kampf gegen der Terrorismus müsse in Afghanistan gewonnen werden, wo sich al-Qaida reorganisiere, während der Irak bezüglich der Terrorismusbekämpfung nicht nur zweitrangig sei, sondern letztlich den transnationalen Terrorstrukturen sogar nutze. Deshalb versprach Barack Obama einen Abzug der US-Truppen aus dem Irak und die Verstärkung jener in Afghanistan. Darüber hinaus kündigte er an, notfalls auch einseitig und ohne Zustimmung der pakistanischen Regierung militärische Operationen in Pakistan gegen al-Qaida-Kader zu unternehmen, wenn man über zuverlässige Informationen über deren Aufenthaltsort verfüge.
Nach dem Amtsantritt Präsident Obamas bekräftigte dieser die Verlagerung der Aufmerksamkeit vom Irak nach Afghanistan und Pakistan. Dieser Grundansatz war nur möglich, weil sich die Sicherheitslage im Irak seit dem Jahreswechsel 2006/2007 deutlich entspannt hatte. Die Zahl der zivilen Gewaltopfer ging von etwa 3700 im Monat auf unter 500 zum Jahresbeginn 2009 zurück, die der Todesopfer unter irakischen Soldaten und Polizisten fiel von monatlich zwischen 150-300 (in den Jahren von 2003-2007) auf nur noch 20-80 zur Jahreswende 2008/2009. Die Zahl der im Irak getöteten US-Soldaten verminderte sich von monatlich mehr als 100 (Spitzenwert: 137) auf unter 20 (8 im Februar 2009). Der Rückgang der Gewalt hatte zwar weniger mit der vorübergehenden Aufstockung der US-Truppenpräsenz im Frühjahr und Sommer 2007 als mit einer verbesserten innenpolitischen Situation zu tun (etwa der selbstverschuldeten Isolierung der al-Qaida-nahen Kämpfer auch in den sunnitischen Siedlungsgebieten und der Krise und Fragmentierung der schiitischen Miliz Muqtada Sadrs), war aber trotzdem real und politisch entlastend.
Dieser Trend, insbesondere die gesunkenen US-Verluste, ließen einerseits die Bedeutung des Irak-Krieges in der US-Öffentlichkeit sinken, zugleich verschafften sie der neuen Regierung den Spielraum im Irak, ihre Versprechen bei geringerem Risiko einlösen zu können. Darüber hinaus war nach Abschluss des Wahlkampfes kaum noch ein Streit bezüglich der Irak-Politik zu bemerken, auch die meisten Politiker der Republikanischen Partei trugen die neue Politik im Wesentlichen mit. Präsident Obama brachte seine neue Politik anlässlich einer Rede vor US-Soldaten folgendermaßen zum Ausdruck:
“By August 31, 2010, our combat mission in Iraq will end. (…) After we remove our combat brigades, our mission will change from combat to supporting the Iraqi Government and its security forces as they take the absolute lead in securing their country. As I have long said, we will retain a transitional force to carry out three distinct functions: training, equipping, and advising Iraqi security forces as long as they remain nonsectarian; conducting targeted counterterrorism missions; and protecting our ongoing civilian and military efforts within Iraq. Initially, this force will likely be made up of 35,000 to 50,000 U.S. troops. Through this period of transition, we will carry out further redeployments. And under the status of forces agreement with the Iraqi Government, I intend to remove all U.S. troops from Iraq by the end of 2011.”
Zusätzlich zu diesem schrittweisen Truppenrückzug kündigte der Präsident zwei weitere Politikakzente an: zum einen eine Reihe politischer, diplomatischer und ziviler Initiativen, die insbesondere die Governance-Strukturen im Irak stärken und die Position der irakischen Regierung festigen sollen; zum anderen aber einen stärker regionalen Politikansatz, der wie bereits dargestellt auch Syrien und den Iran nicht mehr ausschließen solle. Diese Herangehensweise erläuterte er so, wobei er zudem die Verschiebung der Akzente auf Afghanistan und Pakistan unterstrich:
„This reflects a fundamental truth: We can no longer deal with regional challenges in isolation. We need a smarter, more sustainable, and comprehensive approach. That is why we are renewing our diplomacy, while relieving the burden on our military. That is why we are refocusing on Al Qaida in Afghanistan and Pakistan, developing a strategy to use all elements of American power to prevent Iran from developing a nuclear weapon, and actively seeking a lasting peace between Israel and the Arab world. And that is why we have named three of America's most accomplished diplomats – George Mitchell, Dennis Ross, and Richard Holbrooke – to support Secretary Hillary Clinton and myself as we carry forward this agenda.”
Tatsächlich haben sich Afghanistan und Pakistan zu den zentralen Krisenpunkten der US-Außenpolitik und der regionalen Stabilität entwickelt. Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert sich seit 2004 dramatisch. Die Zahl der ausländischen Truppen in Afghanistan wuchs vom März 2003 bis Ende 2008 von etwas mehr als 14.000 auf rund 65.000, während zugleich die Gewalt massiv eskalierte: 2007 sollen schätzungsweise 6000 bis 8000 Menschen Opfer direkter Gewalteinwirkung geworden sein. 2005 gab es nach Angaben des US-Militärs im Monatsdurchschnitt 400 gewaltsame Angriffe durch Aufständische, 2006 und 2007 rund 800, und 2008 etwa 1000 Angriffe pro Monat. Die Zahl der Selbstmordanschläge – früher in Afghanistan unbekannt – stieg von 21 (2005) auf 160 im Jahr 2007. Seit Mai 2008 liegen die Verluste an getöteten US-Soldaten in Afghanistan über denen im Irak, wo nach wie vor weitaus mehr US-Truppen stationiert sind. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass im Verlauf des Jahres 2009 mindestens 20.000 zusätzliche US-Soldaten nach Afghanistan verlegt werden, möglicherweise noch deutlich mehr. Auch andere NATO-Verbündete haben eine Aufstockung ihrer Militärpräsenz angekündigt oder bereits damit begonnen, wenn auch in weit bescheidenerem Umfang.
Allerdings führt eine solche Truppenverstärkung nicht zwangsläufig zur Beruhigung der Situation. Hohe US-Offiziere haben mehrfach darauf hingewiesen, dass für einen militärischen Sieg zwischen 300.000 bis 600.000 Soldaten nötig seien – der ISAF-Oberkommandierende General McNeill hatte 2008 erklärt, dass 400.000 erforderlich seien, um das Land wirklich zu befrieden. Aber selbst solche Truppenzahlen wären sicher keine Garantie für einen Erfolg – und aus politischen, personellen und finanziellen Gründen sind sie ohnehin unrealistisch. Deshalb dürfte – wie im Irak – eine Stabilisierung und Befriedung des Landes überwiegend von politischen Faktoren abhängen, und auf diesem Feld erscheint die Situation problematisch. Präsident Karzai ist in weiten Teilen der Bevölkerung diskreditiert, der Prozess des State-Building geht außerhalb der größeren Städte kaum voran, und in vielen Landesteilen wird der Staatsapparat aufgrund exzessiver Korruption, Inkompetenz und Missbräuchen eher als Problem denn als Lösung betrachtet. Einen oft kaum vorhandenen oder problematischen Staat durch immer mehr ausländische Soldaten zu schützen löst aber kaum dauerhaft die bestehenden Probleme, sondern kann mittelfristig den Widerstand noch verstärken. Ohne eine Lösung der grundlegenden Governance-Probleme Afghanistans dürfte weder eine Erhöhung noch eine Senkung der ausländischen Truppenpräsenz einen Ausweg aus der akuten Sackgasse darstellen. Es ist gegenwärtig noch nicht erkennbar, ob die Regierung Obama dieses Problem erkannt hat und daraus die angemessenen Schlüsse ziehen wird.
Zum Schlüsselproblem hat sich inzwischen das Nachbarland Pakistan entwickelt. Das spiegelt sich zunehmend in der US-Außenpolitik. Es hat zwei Dimensionen: Erstens stellt Pakistan, insbesondere in seiner Nordwestprovinz und den dortigen Stammesgebieten (Federally Administered Tribal Areas, FATA), einen Rückzugs- und Ruheraum für afghanische Aufständische dar. Die künstlich vom britischen Kolonialismus gezogene Grenze zerteilt das paschtunische Siedlungsgebiet und selbst das einzelner Stämme. Sie wird deshalb häufig von Paschtunen weitgehend ignoriert, aufgrund der schwierigen Topographie (Gebirge) ist die Grenzregion ohnehin kaum zu kontrollieren oder abzuriegeln. Vor diesem Hintergrund spielen die Stammesgebiete eine nicht zu unterschätzende Rolle für den Krieg in Afghanistan. Zweitens aber wurde Pakistan zum Problem, weil der Afghanistankrieg – insbesondere die Präsenz ausländischer Truppen – die Nordwestprovinz mit ihrer überwiegend paschtunischen Bevölkerung gründlich destabilisiert hat und die dortige Gewalt zunehmend den Rest Pakistans in Mitleidenschaft zieht, etwa durch eine Welle des Terrorismus. Inzwischen kommen in Pakistan mehr Menschen durch Krieg und politische Gewalt ums Leben als in Afghanistan, 2008 schätzungsweise 8000 bis 9000. Eine weitere Destabilisierung Pakistans wäre letztlich weitaus bedrohlicher als der Krieg in Afghanistan: Das Land hat 170 Millionen Einwohner, Millionen pakistanische Migranten leben in westlichen Ländern – und Pakistan verfügt über Atomwaffen, vermutlich über 60 bis 80 Sprengköpfe. Chaos oder Fragmentierung Pakistans wären deshalb ein ernstes internationales Problem.
Die Regierung Obama sieht sich in diesem Zusammenhang einem Dilemma gegenüber: Aus taktischen Gründen muss ihr wegen der schwierigen Lage in Afghanistan an einer Abriegelung der afghanisch-pakistanischen Grenze und einer Instrumentalisierung der pakistanischen Streitkräfte für die Bekämpfung paschtunischer Aufständischer sowie internationaler Jihadisten im Grenzgebiet gelegen sein. Genau diese Politik der pakistanischen Regierung stellt aber die Hauptursache für die zunehmende Gewalt in Pakistan dar, die das Land in eine schwere Krise gestürzt hat. Es ist noch nicht erkennbar, dass die neue US-Regierung dieses Dilemma wirklich erkannt hätte und bereit wäre, ihre Politik entsprechend zu ändern. Im Gegenteil: Die wiederholten Erklärungen Präsident Obamas, auch gegen den Willen der pakistanischen Regierung militärisch in Pakistan gegen aufständische Jihadisten vorzugehen, trägt wesentlich zur Diskreditierung der Regierung und einer Destabilisierung des Landes bei.
Bilanz und Perspektiven
Die ersten Schritte und Signale der Obama-Administration deuten eine Wende einiger zentraler Bereiche der US-amerikanischen Politik im Nahen und Mittleren Osten an. Es wird jedoch in Zukunft darauf ankommen, dass es nicht nur zu einem dringend notwendigen Wandel des Umgangsstils mit den Regierungen und der Öffentlichkeit in der Region kommt, sondern auch zu einer Veränderung der langfristigen Strategien, also der Substanz der Politik. Dies beinhaltet die Einsicht, dass sich die Konflikte der Region auf Dauer nicht militärisch lösen lassen, sondern hierzu tragfähige politische Konzepte erforderlich sind. Präsident Obamas Bereitschaft vormals isolierte Akteure miteinzubeziehen bedeutet einen Schritt in die richtige Richtung. Ein deutlicher Bruch mit dem Vorgehen der Bush-Administration, deren Instrumentalisierung der Demokratieförderung und der Terrorismusbekämpfung für die regionale Machtpolitik ist dabei ebenso wichtig wie die Abkehr vom Unilateralismus hin zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit europäischen und anderen Verbündeten. Dies ist auch hinsichtlich der langfristigen strategischen US-Interessen erforderlich. Es wird also darauf ankommen, dass sich der von Barack Obama mit Blick auf die USA so vehement geforderte „change“ auch auf die Politik gegenüber dem Nahen und Mittleren Ostens auswirkt. Dabei hat sich die Ausgangslage im Irak seit Ende 2006 deutlich gebessert – die Nagelproben einer neuen und erfolgreichen Politik werden in Bezug auf Israel und Palästina einerseits und Afghanistan und Pakistan andererseits zu bewältigen sein, mit kaum geringerer Bedeutung der Problematik der früher als „Schurkenstaaten“ isolierten Ländern Iran und Syrien. Sollte die Regierung Obama den Willen, die konzeptionellen Fähigkeiten und das Durchhaltevermögen haben, diese drei grundlegenden Probleme tatsächlich zu bewältigen, entstünde die Chance, in der gesamten Region ein neues Kapitel aufzuschlagen und überkommene Konflikte schrittweise zu lösen. Sollte sie hierbei aus innen- oder außenpolitischen Gründen ihren Schwung der ersten Monate verlieren oder gar zu den Politiken der früheren Regierungen zurückkehren, bestünde die Gefahr, dass sich die zum Teil schon chronischen Konflikte der Region weiter verfestigten.
Anmerkungen
(1) Zu den folgenden Abschnitten siehe auch Jochen Hippler, Intervention, Demokratie, Kontrolle – Die US-Politik im Mittleren Osten, in: ders. (Hrsg.), Von Marokko bis Afghanistan – Krieg und Frieden im Nahen und Mittleren Osten, Hamburg 2008, S. 178-196.
(2) Zur Geschichte der US-Nah- und Mittelostpolitik bis zur Mitte der 1980er Jahre siehe: Charles A. Kupchan, The Persian Gulf and the West – The Dilemmas of Security, London 1987, oder: George Lenczowski, American Presidents and the Middle East, Durham/London 1990.
(3) Vgl. Paul Rogers, The Global War on Terror and its Impact on the Conduct of War, in: George Kassimeris (Hrsg.), The Barbarization of Warfare, New York 2006, S. 189ff.
(4) Vgl. George L. Perry, The War on Terrorism, the World Oil Market and the U.S. Economy, The Brookings Institution, Analysis Paper #7, October 24, 2001, http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2001/1024terrorism_perry/20011024.pdf, S. 1.
(5) Ebenda.
(6) Vgl. International Energy Agency, Oil Market Report- Annual Statistical Supplement for 2005 and User’s Guide, 2006 Edition, Paris, 11 August 2006, S. 14.
(7) Vgl. US Energy Information Administration, Crude Oil and Total Petroleum Imports Top 15 Countries, www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/company_level_imports/current/import.html.
(8) Vgl. Energy Information Administration, World Proved Reserves of Oil and Natural Gas, Most Recent Estimates, http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html.
(9) Eine kritische Analyse des “Krieges gegen den Terrorismus“ bietet z.B.: David Keen, Endless War? – Hidden Functions of the „War on Terror“, London 2006.
(10) Vgl. Jan Hanrath, Demokratie und Demokratieförderung in arabischen Ländern, in: Jochen Hippler (Hrsg.), Von Marokko bis Afghanistan – Krieg und Frieden im Nahen und Mittleren Osten, Hamburg 2008, S. 143-160, hier S. 158.
(11) Vgl. Michael Vlahos, Public Diplomacy as Loss of World Authority, in: Nancy Snow und Philip M. Taylor (Hrsg.), Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York 2009, S. 24-38, hier S. 28ff.
(12) Vgl. Thomas Carothers, Democracy Promotion Under Obama: Finding a Way Forward, Carnegie Endowment for International Peace, Policy Brief 77, Washington February 2009, http://www.carnegieendowment.org/files/democracy_promotion_obama.pdf.
(13) Vgl. American Democracy Promotion: An Open Letter To Barack Obama, http://www.opendemocracy.net/article/idea/american-democracy-promotion-an-open-letter-to-barack-obama.
(14) Vgl. Margret Johannsen: Der Gaza-Krieg - Jüngstes Kapitel in einem endlosen Konflikt, in: Jochen Hippler, Christiane Fröhlich, Margret Johannsen, Bruno Schoch und Andreas Heinemann-Grüder (Hrsg.), Friedensgutachten 2009, Berlin 2009, im Erscheinen.
(15) Vgl. Walter Russel Mead, Change They Can Believe In: To Make Israel Safe, Give Palestinians Their Due, in: Foreign Affairs, Jan/Feb 2009, Vol. 88, No 1, S. 59-76.
(16) Vgl. Clinton Criticizes Israel's Eviction, Demolition Plans, in: Washington Post, Thursday, March 5, 2009; Page A11, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/04/AR2009030400287.html.
(17) Vgl. Nathan Brown, Pointers for the Obama Administration in the Middle East: Avoiding Myths and Vain Hopes, Carnegie Endowment for International Peace, Web Commentary, January 23, 2009, http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=22662&prog=zgp&proj=zme.
(18) Vgl. Clinton Heads to Israel and West Bank Bearing Cash and Caution, in: New York Times, March 2, 2009, Page A9, http://www.nytimes.com/2009/03/02/world/middleeast/02diplo.html?_r=2&scp=3&sq=clinton%20middle%20east&st=cse.
(19) Vgl. Nathan Brown, a.a.O.
(20) Vgl. U.S. Sends Senior Officials to Syria To Revive Relations, in: Washington Post, Wednesday, March 4, 2009, S. A09, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/03/AR2009030300242.html.
(21) Vgl. Jan Hanrath, Der Libanon zwischen Krieg und Dauerkrise, in: Bruno Schoch, Andreas Heinemann-Grüder, Jochen Hippler, Markus Weingardt und Reinhard Mutz (Hrsg.), Friedensgutachten 2007, Berlin 2007, S.149-159, hier S. 152ff.
(22) Vgl. Muriel Asseburg und Volker Perthes, After Gaza – What the United States and Europe must do in the Middle East, in: Internationale Politk, Spring 2009, S. 42-45, hier S. 45.
(23) Vgl. A New Year, a New Beginning - President Obama gives a special New Year's video message to the people and leadership of Iran, 20.3.2009 Washington, http://www.whitehouse.gov/Nowruz.
(24) Vgl. Clinton Offers Iran A Specific Overture - Suggests Inclusion in Afghanistan Parley, in: Washington Post, Friday, March 6, 2009; Page A10, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/05/AR2009030501501.html.
(25) Vgl. Volker Perthes, Iran – Eine politische Herausforderung, Frankfurt a.M. 2008, S. 131f.
Vgl. Michael McFaul, Abbas Milani und Larry Diamond, A Win-Win U.S. Strategy for Dealing with Iran, in: The Washington Quarterly, Winter 2006-07, S. 121-138, hier S. 126.
(26) Vgl. Brookings Institution, Iraq Index - Tracking Variables of Reconstruction & Security in Post-Saddam Iraq, 19. Februar 2009, www.brookings.edu/saban/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq Index/index.pdf, S. 4, 6, 14, 19.
(27) Vgl. Jochen Hippler, Ende in Sicht? Das sinkende Gewaltniveau im Irakkrieg und die Chancen einer dauerhaften Stabilisierung, in: Jochen Hippler, Christiane Fröhlich, Margret Johannsen, Bruno Schoch und Andreas Heinemann-Grüder (Hrsg.), Friedensgutachten 2009, Berlin 2009, im Erscheinen.
(28) Barack H. Obama, Remarks on Military Operations in Iraq at Camp Lejeune, North Carolina, February 27, 2009, US Government Printing Office, www.gpoaccess.gov/presdocs/2009/DCPD200900109.pdf, S. 3.
(29) Ebenda, S. 4.
(30) Vgl. Kenneth Katzman, Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and US Policy, Congressional Research Service RL 30588, 9 February 2009, www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, S. 42.
(31) Vgl. Jochen Hippler, Afghanistan: Kurskorrektur oder Rückzug? Die politischen Folgen aus der Gewalteskalation, Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF), Policy Paper 29, Bonn 2008.
(32) Vgl. Jochen Hippler, Das gefährlichste Land der Welt? – Pakistan zwischen Militärherrschaft, Extremismus und Demokratie, Köln 2008, S. 218ff.
Quelle:
Jan Hanrath / Jochen Hippler
Die US-amerikanische Politik im Nahen und Mittleren Osten unter Präsident Barack Obama,
in: Orient – Deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur des Orients, hrsg. vom Deutschen Orient-Institut in Berlin, Bd. 50, Nr. 2, 2009, S. 56-66
weitere Texte zum Nahen und Mittleren Osten
siehe auch die Texte zu Afghanistan, Pakistan und dem Irak
|