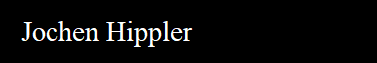

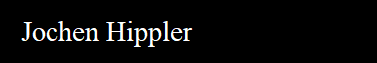 |
 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Jochen Hippler als pdf-Datei Intervention, Demokratie, Kontrolle –
Geschichtliche Voraussetzungen Die aktive Politik und dominierende Rolle der USA im Nahen und Mittleren Osten ist historisch noch relativ jung. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Großbritannien aufgrund seiner – zum Teil schon etwas zurückliegenden – Rolle als Kolonialmacht und durch seine historische Beherrschung der Seewege die Region dominieren. Wegen der geschrumpften weltpolitischen Rolle des eigenen Landes verkündete die britische Regierung 1968 den für 1971 bevorstehenden Rückzug ihrer militärischen Präsenz „östlich von Suez“, also auch im Persischen Golf. Die alte Vorherrschaft Großbritanniens wurde ersetzt durch eine Situation, die auf der einen Seite eine graduell stärkere Unabhängigkeit ehemals abhängiger Staaten der Region sah, zugleich zuerst noch eine Form des Nebeneinanders Großbritanniens und der USA, die von Zusammenarbeit und Konkurrenz zugleich bestimmt war. Dieses Gleichgewicht verschob sich in den folgenden Jahren immer mehr zu den USA. Dabei konzentrierte sich deren Einflussnahme anfangs fast ausschließlich auf zwei Schlüsselstaaten der Region (wenn man von der Militärintervention im Libanon, 1958, absieht), den Iran und Saudi Arabien. Im letzteren Fall wurde die US-Ölgesellschaft ARAMCO zum entscheidenden Hebel. Bezüglich des Irans bestand die besondere Situation, dass es den USA 1953 gelang, mit Hilfe ihres Auslandsgeheimdienstes CIA den Sturz des gewählten Ministerpräsidenten Mossadegh zu erreichen und dem Schah Reza Pahlevi an die Macht zurück zu verhelfen. Damit war ein starker US-Einfluss im Iran – und damit am Persischen Golf - gesichert. Die anderen Staaten der Region wurden von den USA wenig beachtet (Ausnahmen: Saudi Arabien und die Revolution im Irak). Auch die US-Beziehungen zu Israel waren damals nicht sonderlich eng – die israelischen Atomwaffen beispielsweise wurden zuerst vor allem mit französischer, nicht US-Unterstützung entwickelt. Trotz der Reduzierung westlicher Militärpräsenz nach dem britischen Rückzug hielten die USA es bis 1978/79 (dem Zeitpunkt der Revolution im Iran) nicht für nötig, ihr eigenes Engagement zu vergrößern. Dieses bestand seit 1949 vor allem aus drei Kriegsschiffen, der MIDEASTFOR (Middle East Forces, US Navy). Ein wichtiger Grund für die US-amerikanische Zurückhaltung im Golf bis zum Ende der 1970er Jahre bestand in der Niederlage im Vietnamkrieg und der daraus resultierenden „Nixon-Doktrin", die Ende der sechziger Jahre verkündet wurde. Diese Doktrin zog eine Lehre aus Vietnam, indem sie direkte US-Militärinterventionen in der Dritten Welt ablehnte und durch die Unterstützung regionaler Stabilitätsgaranten ersetzen wollte. Im Zuge dieser Position blieb die offene US-Präsenz gering. Stattdessen betrieb Washington eine „Zwei-Säulen-Politik", die den Iran und Saudi Arabien unterstützte und aufrüstete, damit diese Länder im US-Sinne am Golf Ordnung halten würden. Die Jahre 1979/80 wurden aufgrund dreier Entwicklungen zum Wendepunkt der US-Nah- und Mittelostpolitik: Trotz der zuvor massiven militärischen Aufrüstung der beiden Stellvertreter am Golf brach die iranische Hauptsäule der Zwei-Säulen-Politik mit der islamischen Revolution Ende der siebziger Jahre zusammen. Saudi Arabien war nicht in der Lage, die alte Rolle des Iran mit zu übernehmen, ohne sich selbst zu destabilisieren. Die sowjetische Militärintervention in Afghanistan wurde in Washington als Vordringen Moskaus in Richtung Persischer Golf und zu den dortigen Ölvorkommen interpretiert. Als im September 1980 der Irak den nunmehr scharf antiamerikanischen Iran (wenn auch mit US-amerikanischer Sympathie und Unterstützung) überfiel, schien die Phase US-kontrollierter Stabilität am Golf erst einmal vorbei. Im Januar 1980 wurde das Steuer der US-amerikanischen Mittel-Ost-Politik scharf herumgeworfen: Präsident Carter verkündete, dass die USA nun jeden Versuch „äußerer Mächte", die Golfregion zu kontrollieren, „als Angriff auf ihre vitalen Interessen“ verstanden und mit allen, auch militärischen Mitteln, zurückweisen würden. Diese Erklärung wurde bald als „Carter-Doktrin" bezeichnet und von der Reagan-Administration aufrechterhalten. Sie war ein Bruch mit der alten Nixon-Doktrin, da sie sich nicht mehr nur auf lokale Stellvertreter verlassen wollte, sondern eine direkte US-Militärintervention androhte. Der erste Außenminister der Reagan-Administration, Alexander Haig, wollte die entstandene unstabile Lage in der Region anfangs damit kompensieren, dass er sich im Nahen und Mittleren Osten um die Erreichung eines „strategischen Konsenses“ bemühte. Dieser sollte darin bestehen, alle konservativen und westlich ausgerichteten Staaten der Region (einschließlich Israel) gemeinsam gegen die „sowjetische Bedrohung“ zu organisieren. Da diese vorgebliche gemeinsame Gefahr von den Staaten der Region nicht ernst genommen wurde, zugleich die Differenzen zwischen den arabischen Staaten und zwischen diesen und Israel unüberbrückbar waren, zeichnete sich das Scheitern dieses „strategischen Konsenses“ bald ab. Die US-Regierung reagierte mit einer Politikmischung, die die Probleme nicht gerade verminderte: einerseits verkündete sie eine neue „strategische Allianz“, die nun allerdings nur die USA und Israel verbinden sollte. Damit wurden die Beziehungen der USA zu den arabischen Staaten allerdings nicht eben erleichtert. Zugleich bemühte man sich um die Verstärkung des eigenen militärischen Engagements in der Region, was bald die Entsendung von Truppen in den Libanon (1983/84), Luftangriffe auf Libyen (1986) und teilweise umfangreiche Manöver einschloss. Auch diese Politik machte es den konservativen Regierungen oft schwer, eng mit den USA zu kooperieren — selbst wenn sie dies wollten. Zugleich bemühte sich die US-Regierung um enge Beziehungen zu eben gerade diesen Regierungen arabischer Staaten, also zu Saudi Arabien, Ägypten, Jordanien und anderen. Am Rande der Region wurde Afghanistan nach der sowjetischen Intervention (Ende 1979) von Washington durch die größte CIA-Operation der Geschichte zum letzten großen Schlachtfeld des Kalten Krieges gemacht, um die wirtschaftlich stagnierende Sowjetunion unter Druck zu setzen. Umfangreiche Waffenlieferungen und die Organisation eines „amerikanischen Dschihad“ erzwangen 1988/89 den sowjetischen Abzug, führten aber danach zur massiven Ausbreitung kampferfahrener islamistischer Kader im fast ganzen Nahen und Mittleren Osten.
Vorbereitung direkter Militärintervention Die seit 1980 bestehende prinzipielle Bereitschaft zu direkter Militärintervention in der Region durch Washington stieß zuerst auf das praktische Hindernis, dass militärische und logistische Defizite ein solches Engagement kaum gestatteten. Diese Probleme waren bereits in der Mitte der siebziger Jahre öffentlich diskutiert worden. Entsprechend wurden beträchtliche Anstrengungen unternommen, die praktischen Voraussetzungen für eine aktive, militärisch ausgerichtete Politik in der Region zu schaffen. Eines der Kernstücke dieser Bemühungen war die im März 1980 gegründete Rapid Deployment Force, RDF (Schnelle Eingreiftruppe). Sie erhielt ein Hauptquartier in Fort McDill/Florida mit einem eigenen Kommandostab. Dieser wurde zuerst dem US Army Readiness Command, dann direkt dem Verteidigungsminister bzw. dem Gemeinsamen Generalstab der Waffengattungen unterstellt. Im Januar 1983 schließlich wurde die RDF umorganisiert und zu einem selbständigen, einheitlichen Regionalkommando aufgewertet, dem US-CENTCOM (US Central Command) mit Zuständigkeit für die Länder des Nahen und Mittleren Ostens, Ostafrika und Zentralasien. RDF und CENTCOM verfügten (bzw. verfügen) allerdings nicht über eigene Truppen. Bei bevorstehenden Einsätzen oder in Krisensituationen werden dem CENTCOM bestimmte, in der Regel besonders gut ausgebildete und ausgerüstete, militärische Einheiten zugewiesen. Das Problem dieser Interventionsstreitmacht war zu Beginn der Transport und die Logistik und, damit zusammenhängend, ihre eventuelle Stationierung in der Region. Die Stützpunktfrage war von entscheidender Bedeutung, da die Kampftruppen ggf. in die Nähe eines möglichen Konfliktherdes gebracht werden mussten, um von dort aus zu einem Einsatz transportiert zu werden. Andererseits bot die Stützpunktfrage auch die einzige Möglichkeit, die Transportprobleme zu vermindern: nur durch vorherige Deponierung von Großwaffen, Munition, Fahrzeugen, Benzin und anderem Material in der Nähe des erwarteten Kriegsschauplatzes konnte es gelingen, große Mengen von Truppen schnell an Ort und Stelle zu bringen: ihre Waffen und Ausrüstung sollten schon bereitstehen. Heute verfügt CENTCOM über Stützpunkte in Kuwait, Bahrain, Qatar, den Vereinten Arabischen Emiraten, dem Oman, Pakistan und in Djibouti. Dazu kommen unterschiedliche Formen militärischer Kooperation mit der Türkei, Israel, Ägypten, Saudi Arabien und anderen Ländern. Die Kriege in Afghanistan und dem Irak werden unter CENTCOM-Kommando geführt. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die USA in der Region des Persischen Golfes und dessen Umgebung seit den 1980er Jahren ein beachtliches Netz militärischer Stützpunkte aufbauen konnten, das für eigene Militäroperationen zur Verfügung steht. Allerdings werden dadurch die prinzipiell bestehenden logistischen Probleme nur gemildert, nicht aufgehoben und eine ganze Reihe der zur Verfügung stehenden Einrichtungen können aufgrund politischer Einschränkungen nur unter bestimmten Bedingungen genutzt werden. Die massive Ausweitung des militärischen Engagements der USA im Persischen Golf begann 1987, also in der Schlussphase des Ersten Golfkrieges (zwischen Irak und Iran, 1980-88). Die Regierung Kuwaits hatte seit September 1986 Washington um die Entsendung von Marineeinheiten zum Schutz kuwaitischer Schiffe - vorwiegend Tanker - im Persischen Golf gebeten und in diesem Zusammenhang eine „Umflaggung" kuwaitischer Tanker unter US-Flagge ins Spiel gebracht. In dieser Ausgangslage begannen die USA mit einem groß angelegten militärischen Aufmarsch im Golf, der sich faktisch gegen den Iran richtete: Im Juli 1987 hatten sie bereits 15 oder 16 Kriegsschiffe vor Ort. Im Oktober schließlich lag die Zahl bei mehr als 40 (gelegentlich fast 50) Kriegsschiffen mit etwa 30.000 Soldaten. Dies war die größte und kampfkräftigste Flottenkonzentration eines Staates seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Dass diese ausgerechnet im Persischen Golf operierte, demonstrierte, dass die früher geringe Aufmerksamkeit Washingtons für die Region sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt hatte. Die nächste Stufe US-amerikanischer Militärpolitik im Nahen und Mittleren Osten nach dieser maritimen Machtdemonstration bestand im zweiten Golfkrieg (1990/91), zu dem die USA etwa eine halbe Million Soldaten in Saudi Arabien zusammenzogen, im Januar 1991 mit wochenlangen, massiven Luftangriffen den Irak entscheidend schwächten und dann mit einer kurzen Bodeninvasion in nur 100 Stunden die irakischen Truppen aus dem besetzten Kuwait vertrieben. Aufgrund der – von Washington mit provozierten – Aufstände in den kurdischen und schiitischen Landesteilen des Irak befürchtete die US-Regierung eine Schwächung der Türkei und eine Stärkung des Iran oder gar ein Auseinanderbrechen des Irak, so dass sie auf den Sturz Saddam Husseins verzichtete und diesem gestattete, die Ausstände brutal niederzuschlagen.
Die strategischen Grundinteressen der USA Die Politik Washingtons im Nahen und Mittleren Osten wird – vor allem in den letzten Jahren – häufig mit moralischen und wertegestützten Argumenten begründet („Freiheit“, „Demokratie“), beruht aber tatsächlich auf drei Kerninteressen:
Diese drei Interessendimensionen ergänzen sich nicht automatisch, sondern können durchaus in Widersprüche geraten: So kann sich die grundsätzliche Unterstützung Israels zwar auf breite innenpolitische Unterstützung (inzwischen auch aus Kreisen fundamentalistischer Christen, die der Republikanischen Partei nahe stehen, etwa der Strömung der „Christlichen Zionisten“ oder nach der Einschätzung des Fernsehpredigers Jerry Falwell, wonach die besonders christlich geprägten Landesteile „das Sicherheitsnetz Israels“ seien) und eine teilweise ideologische Nähe zur israelischen Politik stützen (insbesondere deren anti-iranische und anti-syrische Tendenz), untergräbt aber häufig die regionale Stabilität, wenn Washington z.B. die israelische Besatzungspolitik in Palästina oder dessen Krieg gegen den Libanon (2006) faktisch unterstützt. Eine solche Politik kann auch weiter entfernte, pro-amerikanische arabische Regime in Schwierigkeiten bringen, die so bei der eigenen Bevölkerung diskreditiert werden. Die prinzipielle Positionierung an der Seite Israels macht auch die Politik zur Kontrolle der Ölregion am Persischen Golf nicht leichter. Hier soll stärker auf die Bedeutung der Energiesicherung als Kerninteresse US-amerikanischer Regionalstrategie eingegangen werden. Das US-Interesse an Ölimporten hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht. Standen beispielsweise 1970 einem US-Verbrauch von 14,7 Millionen barrel (ein Fass von 159 Liter) pro Tag noch 11,7 Millionen barrel eigener Ölproduktion gegenüber (die USA produzierten also fast 80 Prozent ihres Ölbedarf im eigenen Land), so hatte sich dies bis zur Jahrtausendwende entscheidend geändert. Im Jahr 2000 verbrauchten die USA 19,7, förderten aber nur noch 9,1 Millionen barrel pro Tag, also etwas mehr als 46 Prozent des Eigenbedarfs. In dieser Zeit ging der Anteil der USA an der Weltölproduktion von 23,9 auf 11,8 Prozent zurück, während der am weltweiten Verbrauch nur von 31,4 auf 26 Prozent sank. Zugleich drängten andere Länder massiv auf den Energiemarkt: China verbrauchte 2004 fast die dreifache Menge Öl wie 1990 und damit schon zweieinhalb mal so viel wie Deutschland. Die USA decken gegenwärtig ihren eigenen Importbedarf nur zum kleineren Teil im Nahen und Mittleren Osten. Ihre wichtigsten Lieferanten für Rohöl sind Kanada (rund 2 Mill. barrel pro Tag), Mexiko (knapp 1,5 Mill.), Saudi Arabien (1,4), Venezuela (1,1), Nigeria (0,9) und der Irak (knapp 0,6 Mill. barrel pro Tag, dicht gefolgt von Angola; alle Zahlen aus dem November 2006). Nun darf aus dieser geographischen Verteilung allerdings nicht geschlossen werden, dass die USA vom Öl des Persischen Golfes und den Vorkommen in Zentralasien unabhängig wären – der Ölmarkt ist global, und bei einer Situation teilweise bereits sinkender Fördermengen und deutlich wachsender Nachfrage (gerade durch China und andere asiatische Länder) werden der Golf und Zentralasien zukünftig an wirtschaftsstrategischer Bedeutung eher noch zunehmen. Sieht man sich die nachgewiesenen Ölreserven auf der Welt an, wird dies noch unterstrichen. Von den sechs Ländern mit den größten Ölreserven liegen fünf am Persischen Golf, nämlich Saudi Arabien (nachgewiesene Ölreserven von 263 Mrd. barrel, fast 20 Prozent der Weltreserven), Iran (133 Mrd. barrel; 10 Prozent der weltweiten Ölvorkommen), Irak (113), Vereinigte Arabische Emirate (98), und Kuwait (97; zusammen weitere fast 23 Prozent der Weltölvorkommen). Nehmen wir noch Katar (16 Mrd. barrel), den Oman (6) und die nicht am Golf gelegenen Länder der Großregion hinzu (Libyen: 40; Kasachstan: 26; Algerien: 12; Jemen: 4 Mrd. barrel), dann ergibt sich bereits heute die überragende Bedeutung des Nahen und Mittleren Ostens für die Weltenergieversorgung. Bedacht werden muss dabei auch, dass in einer Reihe dieser – und anderer– Länder auch Erdgas in großer Menge vorhanden ist. Einer Supermacht wie den USA, die zunehmend von Ölimporten abhängig wird, kann eine solche Region deshalb nicht gleichgültig sein. Die berühmte Formulierung von Henry Kissinger (ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater und danach Außenminister der USA), „Öl ist ein viel zu wichtiges Gut, als dass man es den Arabern überlassen könnte“, die von zwei ehemaligen UNO-Diplomaten berichtet wird, bringt eine in Washington verbreitete Sichtweise deutlich auf den Punkt. Aber den USA geht es nicht darum, die Ölvorkommen der Region einfach militärisch zu besetzen und das Öl abzupumpen, sondern um ihre strategische Dominanz. Der damalige US-Präsident George Bush Senior erklärte dies vor dem Golfkrieg von 1991, als es um die irakische Besetzung Kuwaits ging: „Der Irak selbst kontrolliert etwa 10 Prozent der Welterdölreserven. Mit Kuwait kontrolliert er die doppelte Menge. Ein Irak, dem es gestattet wäre, Kuwait zu schlucken, würde die wirtschaftliche und militärische Macht, aber auch die Arroganz besitzen, seine Nachbarn einzuschüchtern und unter Druck zu setzen - Nachbarn, die den Löwenanteil der übrigen Welterdölreserven kontrollieren. Wir können es nicht zulassen, dass solch lebenswichtige Bodenschätze von jemandem beherrscht werden, der so rücksichtslos handelt. Und wir werden es nicht zulassen." Es geht bei der Politik der US-Administration gegenüber dem Golf zwar um Öl – aber nicht darum, den Fluss des Öls physisch bzw. direkt militärisch zu sichern. Das ist kaum nötig, da das Öl der Region bereits zum Verkauf steht: Alle Länder müssen es aus wirtschaftlichen Gründen exportieren, dazu zwingen braucht man sie nicht. Es geht auch kaum um die militärische Senkung der Ölpreise – das wird von Politikplanern in Washington gelegentlich als Ziel formuliert, ist aber durch militärische Dominanzpolitik oder Krieg kaum zu erreichen. Ganz im Gegenteil: Der Golfkrieg von 1990/91 führte dazu, den Ölpreis pro barrel von 17 auf über 45 Dollar zu erhöhen, konnte diesen Anstieg zumindest nicht verhindern. Auch 2003 bestand diese Gefahr: das Wall Street Journal (20. Dezember 2002) wies bereits vor Kriegsbeginn darauf hin, dass gerade angesichts der Streiks in der Ölindustrie Venezuelas ein kriegsbedingter Ausfall der irakischen Exporte das Preisniveau weiter heben müsste – insbesondere angesichts der Entscheidung der OPEC, ab dem 1. Januar 2003 die Produktion um 1,7 Mill. barrel pro Tag zu kürzen. Bereits kurz darauf stieg der Ölpreis um rund 20% auf rund 30 Dollar. Nach dem Irakkrieg von 2003 erreichte er tatsächlich neue Höhen von zeitweise über 70 Dollar. Das Politikziel besteht also weder in der physischen Eroberung des Öls noch in einer direkten Marktregulierung (im Sinne einer erzwungenen Preissenkung) durch Krieg, sondern tatsächlich in dem, was Präsident Bush erläutert hatte: der Verweigerung einer Vormachtstellung am Golf durch irgendeine nicht befreundete Macht. Weder der Irak noch der Iran (Saudi Arabien kommt dafür kaum in Frage, die Sowjetunion ist ausgeschieden, Russland fehlt hier das Gewicht) durften oder dürfen nach dieser Ansicht die geostrategisch wichtige Region dominieren. (Dies war natürlich noch anders, als bis 1978 der befreundete Schah den Iran regierte – damals wurde er gezielt zum regionalen Stellvertreter der USA aufgerüstet.) Das beste Mittel, fremden Einfluss oder gar Vorherrschaft dauerhaft zu verhindern ist, die Region selbst politisch und militärisch zu dominieren. Das starke US-Interesse am Persischen Golf basiert auf seinem Energiereichtum, auf seiner Bedeutung für die Weltwirtschaft durch die Ölvorkommen - aber eben nicht auf eine direkte und ungebrochene Art und Weise, sondern politisch vermittelt. Ein „Krieg für Öl“ ist dies aus Washingtoner Sicht deshalb nur indirekt (ganz im Gegensatz zur damaligen Eroberung Kuwaits durch den Irak, die tatsächlich vor allem aus wirtschaftlichen Gründen erfolgte), sondern ein Kampf, die reichen Energieressourcen des Golfs nicht zur Basis einer fremden Machtausdehnung werden zu lassen und zugleich am Golf einen politisch stabilen Rahmen eigener Hegemonie zu etablieren, der die regionalen Öl-Exporteure quasi naturwüchsig an die USA bindet, ohne den Fluss des Öls selbst kontrollieren zu müssen. Zugleich wird eine eindeutige US-Dominanz in der Region den USA strategische Positionsvorteile gegenüber anderen großen Ölimporteuren verschaffen, die dort zwar über noch stärkere wirtschaftliche Interessen, aber kaum politischen Einfluss verfügen.
Der US-„Krieg gegen den Terror“ und die Demokratisierungsoffensive als Teile der Regionalpolitik In diesem Zusammenhang geostrategischer Machtpolitik sollte auch der „Krieg gegen den Terrorismus“ eingeordnet werden. Die Anschläge des 11. September 2001, denen etwa 2900 Menschen zum Opfer fielen, änderten die Wahrnehmung der eigenen Sicherheit in der amerikanischen Gesellschaft und der Regierung. Während große Teile der Bevölkerung sich persönlich verunsichert und bedroht fühlten (vor allem in den Großstädten), begriff die US-Regierung den Terroranschlag nicht allein als kriminellen Gewaltakt, sondern als Angriff auf die globale US-Hegemonie. Zum ersten mal waren außenpolitische Konflikte in diesem Maße in die USA hineingetragen worden, waren gerade die Symbole amerikanischer Macht in den USA selbst zum Ziel eines Angriffs gemacht worden: das World Trade Center als Symbol der wirtschaftlichen, das Pentagon als Symbol der militärischen, und das Weiße Haus (als Ziel eines weiteren, vorher abgestürzten Flugzeugs) als Symbol der politischen Macht. Auch deshalb ging die Reaktion der US-Regierung über bloße Terrorbekämpfung weit hinaus. Die neue Dominanz der Terrorbekämpfung in der Außenpolitik der Bush-Administration speist sich aus vier Quellen: einmal geht es tatsächlich um die Bekämpfung des Terrorismus, was nicht nur vernünftig, sondern auch innenpolitisch notwendig ist. Keine US-Regierung könnte es sich leisten, „weich“ oder gleichgültig auf die Anschläge des September 2001 zu reagieren. Zweitens zielt die neue Politik auf die Neuordnung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens. Dazu gehört aus Sicht Washingtons auch der Sturz unliebsamer Regierungen („Schurkenstaaten“), die zu Recht oder zu Unrecht mit dem Terrorismus in Verbindung gebracht werden. Hier verbinden sich die Regionalinteressen der einzigen Weltmacht mit dem Ziel der Terrorbekämpfung, etwa durch die Unterordnung letzterer unter die Regionalstrategie oder durch die Legitimierung regionaler Machtpolitik als Terrorbekämpfung. Drittens wird der Topos der Terrorbekämpfung mit anderen Politikzielen der US-Regierung verknüpft, etwa der Verweigerung von Massenvernichtungswaffen an außenpolitische Gegner. Und schließlich bildet der Anti-Terror-Kampf ein Mittel, die eigene globale Führungsrolle zu zementieren und verstetigen, wenn dieser Aspekt auch durch den Irakkrieg etwas in den Hintergrund trat. Für uns sind hier zwei Elemente wichtig: Einmal das kriminalistische, geheimdienstliche und militärische Vorgehen gegen terroristische Gruppen und Verdächtige. Dazu gehören Fahndung, Verhaftung, Folterung oder Ermordung verdächtiger Personen, das Aufspüren finanzieller Transaktionen, die Zerschlagung terroristischer Infrastruktur und andere Mittel. Zweitens betreiben die USA mit der Begründung des anti-terroristischen Kampfes eine scharfe Politik gegen einige „Schurkenstaaten“, die letztlich auf den Sturz ihrer Regierungen und die politische Neuordnung der gesamten Region gerichtet ist. Die Kriege in Afghanistan zum Sturz der Taliban (2001) und gegen den Irak (2003) gehören in diesen Zusammenhang. Dabei ist erkennbar, dass diese Politik über die Terrorismusbekämpfung weit hinausgeht: So repressiv das Regime Saddam Husseins auch war, so wenig hatte es mit dem internationalen Terrorismus im Allgemeinen und al-Qaida im Besonderen zu tun. Trotzdem wurde der Krieg gegen den Irak durch Washington (außer mit nicht-existierenden Massenvernichtungswaffen) vor allem damit gerechtfertigt, dass der Irak ein „zentrales Schlachtfeld gegen den Terrorismus“ gewesen sei, so etwa Vizepräsident Cheney im August 2002 und der damalige Außenminister Powell zum Jahresbeginn 2003 vor dem UNO-Sicherheitsrat. Selbst der Auslandsgeheimdienst CIA hatte aber keine Belege für eine Verbindung des Irak zum internationalen Terrorismus. Bereits daran wird erkennbar, dass der US-„Krieg gegen den Terrorismus“ nur teilweise der Terrorismusbekämpfung dient, daneben aber eine offensive Regionalpolitik im Nahen und Mittleren Osten verhüllt und legitimiert. Ähnlichen Zwecken dient die US-Politik einer Förderung der Demokratie im Nahen und Mittleren Osten, die ebenfalls zur Begründung des Krieges im Irak herangezogen, aber vor allem nach Kriegsende auch in Bezug zu Afghanistan verwendet wurde. Nun ist unbestreitbar, dass der Kampf gegen den Terrorismus – soweit er sich gegen die USA und ihre Verbündeten richtet – tatsächlich ein dringendes Anliegen der US-Regierung ist, so wie man auch annehmen kann, dass sie prinzipiell demokratische Regierungsformen positiver bewertet als diktatorische, zumindest solange diese marktwirtschaftlich orientiert sind und den US-Interessen nicht entgegenstehen. Genau letzteres kann aber auch nicht der Fall sein, wenn etwa in Palästina die USA und die EU 2005 erst massiv auf eine demokratische Parlamentswahl drängten, um anschließend den Wahlsieg der Hamas aus politischen Gründen nicht anzuerkennen. Auch in Pakistan finden die USA es wegen Afghanistan nützlicher, den an die Macht geputschten General Musharraf 2004 zum „wichtigen strategischen Verbündeten“ („major non-NATO ally“) zu erklären, als sich den Unsicherheiten demokratischer Verhältnisse auszusetzen. Von einem mehr als rhetorischen Drängen auf demokratische Verhältnisse im vom Königshaus diktatorisch regierten Saudi Arabien oder bei anderen US-Partnern in der Region kann kaum die Rede sein. All dies bedeutet nicht, dass die USA gegen demokratische Verhältnisse im Nahen und Mittleren Osten wären, aber dass ihr demokratischer Kreuzzug höchst selektiv geführt wird und vor allem dann zum Tragen kommt, wenn er entweder ein gegnerisches Regime destabilisieren kann oder den USA nichts kostet, das US-Interessen direkt berührt.
Die Kriege gegen Afghanistan und den Irak Gemessen an seinen ursprünglichen Zielen kann der Krieg in Afghanistan als gescheitert gelten. Die Bush-Administration hatte zwei Ziele in den Vordergrund gestellt: die Zerschlagung Al-Qaidas und die Ergreifung oder Tötung der Chefs von Al-Qaida und der Taliban, Usama bin Ladin und Mullah Muhammad Omar. Beides wurde trotz des beträchtlichen militärischen Aufwandes nicht erreicht: Der damalige CIA-Chef Tenet erklärte bereits im Oktober 2002 vor einem Kongressausschuss, dass Al-Qaida so gefährlich sei wie zuvor, möglicherweise noch gefährlicher: „Die bedrohende Lage, der wir uns heute befinden, ist so schlecht wie im vergangenen Sommer. … Sie sind zurück. Sie sind hinter uns her. Sie planen auf vielen Ebenen. Sie haben vor, die Heimat erneut anzugreifen.“ Damit drängte sich die Frage auf, was das erste Jahr des Anti-Terror-Krieges und der Feldzug in Afghanistan unter dem Gesichtspunkt der Terrorismusbekämpfung gebracht hatten. Inzwischen haben sich schwere Anschläge in Madrid, London, Istanbul und anderswo ereignet, und die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich drastisch weiter verschlechtert. Im Oktober 2003 äußerte auch der damalige Verteidigungsminister Rumsfeld in einem internen Memorandum des Verteidigungsministeriums ernste Zweifel, ob die USA dabei waren, den Kampf gegen den Terrorismus zu gewinnen. Er sprach von „gemischten Ergebnissen“ in Bezug auf Al-Qaida, beklagte, dass man nicht wisse, „ob wir den globalen Krieg gegen den Terrorismus gewinnen oder verlieren“. Er schrieb; „Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist zu unseren Ungunsten! Uns kostet es Milliarden, den Terroristen Millionen.“ Seitdem ist die Situation in vielen Bereichen eher schwieriger geworden. Die beiden gesuchten bin Ladin und Mullah Omar befinden sich weiter in Freiheit – Usama bin Ladin fühlt sich inzwischen sicher genug, um sich wieder selbst per Tonband zu Wort zu melden. Selbst Präsident Bush formulierte Anfang 2007: „Im letzten Jahr hat sich in Afghanistan die Zahl der Bomben am Straßenrand fast verdoppelt, direkte Angriffe auf die internationalen Streitkräfte haben sich fast verdreifacht, und Selbstmordanschläge sind fast um das fünffache häufiger.“ Inzwischen sind schon deutlich mehr US-Soldaten im Irak getötet worden – von einem Vielfachen am irakischen Zivilisten abgesehen – als es beim 11. September 2001 an Opfern gab. Ein Erfolg der US-Politik zur Bekämpfung von Gewalt und Terrorismus ist daraus nicht zu schließen. Andererseits fasste die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press schon früh das Ergebnis der Afghanistanpolitik so zusammen: “Die Vereinigten Staaten werden voraussichtlich ihre neuen militärischen Bindungen nach Zentralasien auch nach dem Ende des Afghanistan-Krieges behalten oder ausbauen. Das würde eine neue Einflusszone in einer Region schaffen, in der die Stationierung amerikanischen Militärs vor einem Jahrzehnt noch undenkbar war.” Ohne die Betonung der Anti-Terror-Ziele der US-Politik und ohne deren militärische Ausprägung – also ohne den Krieg gegen das Afghanistan der Taliban – wäre diese bedeutende Machtausweitung in der energiereichen Schlüsselregion Zentralasien gegen den gemeinsamen Widerstand der Regionalmächte Russland und China, die sich der neuen Einflusszone Washingtons bis heute widersetzen, unmöglich gewesen. Die US-Politik in Zentralasien zielte bereits vor dem 11. September 2001 auf die Erschließung der beträchtlichen Gas-Ressourcen Zentralasiens, auf die Verstärkung des eigenen und auf die Zurückdrängung des iranischen und russischen Einflusses. Die Anti-Terror-Politik wurde geschickt mit diesen Zielen verknüpft und in ihren Dienst gestellt. Und so zweifelhaft der Nutzen des Afghanistan-Krieges für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus war – insbesondere, wenn man ihn im Zusammenhang mit dem Irakkrieg betrachtet – so erfolgreich war er für die eigene Machtausdehnung in der Region, die heute zum ersten mal in der Geschichte auch militärisch abgesichert ist. Der US-Krieg im Irak ist in kürzerer Zeit noch wesentlich negativer verlaufen. Während der Irak früher eine repressive Diktatur war, herrscht heute Bürgerkrieg, in dem inzwischen nach offiziellen Angaben monatlich mehr als 3.000 Menschen gewaltsam sterben. In einer gründlichen Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet publiziert wurde und auf Stichproben mit mehr als 1800 Haushalten mit über 12.000 Menschen beruhte, kamen die Autoren sogar zur Zahl von über 600.000 Toten im Irak seit dem offiziellen Kriegsende. Darüber hinaus wurde der Irak aufgrund der Besatzungssituation nach dem Krieg tatsächlich zu einer Brutstätte des internationalen Terrorismus, die zahlreiche arabische Dschihadisten anzog und viele politische Aktivisten mobilisierte und radikalisierte. Inzwischen stellt der Irak mit großem Abstand das Zentrum des internationalen Terrorismus dar: Fast 30 Prozent aller Terroranschläge weltweit und 55 Prozent aller terroristischen Todesopfer gab es 2005 im Irak. Sowohl in Afghanistan als auch im Irak unternahmen die USA (im ersten Fall mit breiter internationaler Unterstützung, im zweiten mit einer Koalition der Willigen) im Anschluss an schnell gewonnene Kriege – ohne zuvor die Absicht gehabt zu haben – ambitionierte Projekte des „Nation-Building“, also des Aufbaus neuer nationalstaatlicher Strukturen. Die Bush-Administration war zu Beginn ihrer Amtszeit einer solchen Politik deutlich ablehnend gegenüber gewesen, wenn der Präsident etwa in Bezug auf Afghanistan formulierte: „Wir sind nicht auf Nation-Building aus, wir konzentrieren uns auf Gerechtigkeit“ und immer wieder unterstrich, die Aufgabe US-amerikanischer Soldaten sei kein Nation-Building, sondern „Kriege zu führen und zu gewinnen“. Etwas später wurde diese noch aus dem Wahlkampf stammende Position modifiziert, indem nun Nation-Building nicht mehr prinzipiell abgelehnt, sondern als Aufgabe der UNO bezeichnet wurde, nicht der US-Truppen. Und nachdem man Afghanistan erobert hatte – sowie später den Irak – stellte sich die Frage grundsätzlich anders, und Nation-Building wurde notwendigerweise zu einer wichtigen Aufgabe auch des US-Militärs. Im Februar 2006 schließlich erklärte der US-Präsident es zum Ziel seiner Politik, „einen stabilen, gemäßigten und demokratischen Staat zu errichten“. Die US-Politik zu Nation-Building im Nahen und Mittleren Osten erwuchs also keiner langfristigen Strategie, sondern geriet durch die zunehmenden Probleme nach den militärischen Siegen in beiden Ländern auf die Tagesordnung, weil eine rein militärische Stabilisierung sich schnell als unmöglich erwies. In Afghanistan waren staatliche Strukturen ohnehin extrem schwach und durch den Krieg zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen, während im Irak der unter Saddam Hussein übermächtige Staatsapparat sich bei Kriegsende faktisch innerhalb weniger Tage aufgelöst hatte und die Reste (etwa das Militär) von den USA schnell beseitigt wurden. Vor diesem Hintergrund erfolgte Nation-Building einerseits zur Stabilisierung beider Länder, zweitens als Teil einer Politik der Stärkung neuer politischer Eliten, die die Länder im US-Sinne kontrollieren sollten, und drittens im Kontext der offiziellen Demokratisierungsoffensive, die den Nahen Osten insgesamt umgestalten will. Der Irak sollte durch neue, demokratische Staatlichkeit zum „Schaufenster der Demokratie“ im Nahen und Mittleren Osten werden und in die Nachbarländer ausstrahlen. In den Worten des US-Präsidenten: “Der Erfolg eines freien Irak wird auch anderen Ländern in dieser Region zeigen, dass nationaler Wohlstand und Würde in einer repräsentativen Regierung und freien Institutionen liegen. … (Ein) freier Irak wird den Frieden im Nahen Osten fördern. Und ein freier Irak wird wichtig sein, um die Einstellung der Menschen im Mittleren Osten zu verändern. Ein freier Irak wird zeigen, was in einer Welt möglich ist, die Freiheit braucht, und in einem Teil der Welt, der Freiheit braucht.”
Stärke und Krise der US-Politik im Nahen und Mittleren Osten Dieser positive Vorbildeffekt trat nicht ein, sondern wegen der weiterhin katastrophalen Lebensbedingungen und des bald eskalierenden Bürgerkrieges wurde der Irak zu einem Herd der Instabilität und Gewalt in der Region und zum abschreckenden Beispiel der US-Politik. Selbst der US-Präsident musste Anfang 2007 eingestehen, dass die Lage im Irak am Rande der Katastrophe balancierte. Falls man seiner Politik nicht folge, könne es zu “verheerenden Folgen” kommen: “die irakische Regierung könnte zusammenbrechen, das Chaos würde sich ausbreiten, es gäbe ein Vakuum, in dieses Vakuum würden noch mehr Extremisten und Radikale hineinströmen, Personen, die ihre Absicht erklärt haben, unsere Bevölkerung zu verletzen. … Dieser Konflikt unterscheidet sich von anderen dadurch, dass der Feind uns hierhin folgen wird, wenn wir dort scheitern“. Der scheidende US-Oberkommandierende im Irak, General George Casey, zog bei seiner Ablösung im Februar 2007 die Bilanz: „Nicht alles ist so wie ich es erwartet oder mir für mein Ausscheiden gewünscht habe, aber so sind die Dinge eben.“ Sein Nachfolger, General David Petraeus, beschrieb beim Amtsantritt die Lage im Irak nüchtern so: „Schwierig bedeutet nicht hoffnungslos.“ Von der selbstbewussten und geradezu euphorischen Stimmung des Jahres 2003 („Mission accomplished“) ist in der US-Regierung oder im Militär nichts mehr zu spüren. Je mehr sich im Irak die Sicherheitslage verschlechterte, desto weniger dringlich wurde für Washington der Aspekt der Demokratisierung und um so stärker trat die Stabilisierung und die Eindämmung des Aufstandes in den Vordergrund. Auch dabei war der Aufbau neuer staatlicher Organe zentral: Ohne eine funktionierende irakische Polizei und Militär sah Washington keine Möglichkeit, erst den Widerstand gegen die eigenen Truppen und dann den entstehenden und eskalierenden Bürgerkrieg unter Kontrolle zu bekommen. Ähnlich stellte sich die Lage in Afghanistan dar. Ein wichtiges Problem des US-Politik in beiden Ländern besteht darin, dass einerseits die Verbesserung der Sicherheitslage einen funktionierenden Staatsapparat erfordert, der durch Lösung der politischen und wirtschaftlichen Probleme den Konfliktstau auflöst und durch seine eigenen Sicherheitsapparate entscheidende Beiträge zur Gewaltkontrolle leistet – andererseits aber ein so funktionierender Staat nicht existiert und in einer Bürgerkriegssituation kaum von außen etabliert werden kann. Deshalb neigte die US-Politik schon früh dazu, am lokalen Staatsapparat vorbei mit eigenen Truppen auf repressive Art Sicherheit herstellen zu wollen, was seinerseits bei großen Teilen der Bevölkerung den Eindruck einer robusten Besatzungssituation erweckte und wachsenden Widerstand provozierte. Damit hatte sich Nation-Building zuerst hinter dem Rücken der US-Regierung mangels Alternativen als alleinige Strategie zur Befriedung Afghanistans und des Irak durchgesetzt, wurde durch mangelnde Vorbereitung, schwere politische Fehler, dürftige Umsetzung und eine Reihe schwerer Zielkonflikte in der Praxis aber bald untergraben. Das Ergebnis war in Afghanistan wie im Irak ein weiterhin schwacher, fragmentierter Staatsapparat, der in den eigenen Gesellschaften – trotz demokratischer Wahlen – nur über begrenzte Unterstützung verfügt, sich nur mit massiver finanzieller und militärischer Hilfe externer Akteure halten kann und schwersten gesellschaftlichen Belastungsproben und sicherheitspolitischen Herausforderungen konfrontiert ist. Ein endgültiges Scheitern ist in beiden Fällen damit nicht unausweichlich, aber es kann festgestellt werden, dass von den ursprünglichen, großen Plänen der Bush-Administration, nämlich Afghanistan und den Irak schnell unter Kontrolle zu bringen, sie zu regionalen Stützpunkten US-amerikanischer Hegemonie zu machen, intern zu demokratisieren und von dort aus den Rest des Nahen und Mittleren Ostens im eigenen Sinn umzugestalten, wenig geblieben ist. Heute geht es für Washington insbesondere im Irak nicht mehr um einen „Sieg“ oder die Gestaltung der irakischen Zukunft, sondern um Schadensbegrenzung. Die USA bleiben aufgrund ihrer beträchtlichen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Macht der zentrale Akteur der Region und haben insbesondere ihre militärische Präsenz deutlich ausweiten können. Aber trotzdem ist Washington politisch und militärisch geschwächt: Sein unilaterales und rechtwidriges Verhalten auf dem Weg zum Irakkrieg, seine Unfähigkeit, insbesondere den Irak unter Kontrolle zu bringen und tatsächlich zu einem Modell wirtschaftlicher und demokratischer Entwicklung in der Region zu machen, aber auch sein oft hemdsärmeliges Auftreten in Afghanistan und dem Irak, die „Kollateralschäden“ und die Folterskandale in Abu Ghraib, Afghanistan und Guantanamo haben das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der USA in der ganzen Region – und darüber hinaus – schwer geschädigt. Trotz ihrer militärischen Stärke hat Washington zunehmend Schwierigkeiten, die Anstrengungen beider Kriege dauerhaft zu bewältigen. Das gilt nicht nur personell, sondern auch finanziell: Die inzwischen bewilligten Kriegskosten von insgesamt rund 661 Mrd. Dollar liegen inflationsbereinigt bereits über denen des viel länger dauernden Vietnamkrieges. Damit ist insgesamt die paradoxe Situation eingetreten, dass die Nah- und Mittelostpolitik der Bush-Administration die Position der USA in der Region zugleich ausgeweitet und untergraben hat. Washington ist und bleibt der wichtigste Machtfaktor im Nahen und Mittleren Osten und kann viele unerwünschte regionale Entwicklungen wirksam be- oder verhindern – aber zugleich haben Afghanistan und der Irak demonstriert, das diese beträchtliche Machtfülle nicht genügt, um die Region selbst positiv zu gestalten. Die militärische hard power der USA steckt in der Sackgasse, ihre soft power in der Region ist wesentlich geschmälert. Trotzdem führt im Nahen und Mittleren Osten kein Weg an den USA vorbei.
Fußnoten nur in der Druckfassung
Quelle: Jochen Hippler (Hrsg.)
|
| [ Home ] [ zur Person ] [ Bücher ] [ Aufsätze ] [ Texts in English ] [ Fotos ] [ Blog ] |