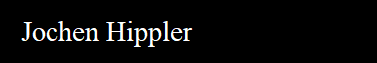

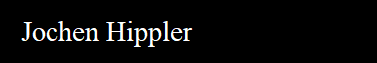 |
 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Jochen Hippler Failed States und Globalisierung
einen von der Ökonomie (insbesondere den internationalen Finanzmärkten) ausgehenden Prozess, der über die Verdichtung und Intensivierung inter-nationaler Beziehungen weit hinausreicht und die Durchsetzung tatsächlich globaler Märkte zum Kern hat. Die alten „Volkswirtschaften“, die ja immer schon international vernetzt waren, werden zunehmend durch einen wirklichen Weltmarkt abgelöst. Dadurch entstehen nicht allein weitere Austauschmechanismen zwischen Staaten und Regionen (was man als Internationalisierung bezeichnen könnte), sondern eben globale, weltweit integrierte Allokationsmechanismen. Als Folge dieses Prozesses ergeben sich für nationalstaatlich organisierte Politik politische Steuerungsprobleme: Regierungen und Parlamente haben weniger Zugriff und Gestaltungsmöglichkeit auf die Setzung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, da diese nun zunehmend auf einer Steuerungsebene oberhalb der Einzelstaaten und Regionen (eben durch globale Märkte) entschieden werden. Dadurch werden Wirtschaftpolitik (inklusive Finanz- und Währungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Konjunkturpolitik, etc.) und Sozialpolitik wesentlich erschwert, soweit sie die allgemeine Globalisierungstendenz nicht nur nachvollziehen möchten. Globalisierung gewinnt über den wirtschaftlichen Bereich hinaus aufgrund der prägenden Kraft der Ökonomie große Bedeutung für den politischen Sektor, die Technologieentwicklung, die Kultur, die Wertebildung und die internationalen Beziehungen. Auch Kultur, Kommunikation, Politik werden „globalisiert“, auch wenn es sich dabei um Sekundärprozesse handelt. Schließlich stellt Globalisierung zwar im Kern einen naturwüchsigen Vorgang dar, der sich aus ökonomischen Prozessen speist (die man früher oft mit den Begriffen Akkumulation und Zentralisierung des Kapitals bezeichnete und im Kommunistischen Manifest bereits einprägsam beschrieben fand), seine Form allerdings wird politisch gestaltet, oder eben auch nicht. Zusammenwirkende Regierungen können Globalisierung bewusst beschleunigen oder verzögern, sie können ihr eine eher marktradikale oder eher „sozialstaatliche“ Ausprägung geben. In diesem Sinne haben Regierungen im Globalisierungsprozess der letzten dreißig Jahre eine wichtige, wenn auch oft fragwürdige Rolle gespielt. Ein so verstandener Globalisierungsprozess verfügt über viele Facetten und Aspekte. Auf einer allgemeinen Ebene mag es hier aber reichen, auf die Verknüpfung seiner globalen Wirkungen mit seinen innergesellschaftlichen hinzuweisen. Die Herausbildung einer oberhalb der Nationalstaaten angesiedelten Wirtschafts- und Politikebene bedeutet ja gerade nicht, dass sich in den einzelnen Gesellschaften und zwischen den sozialen Gruppen innerhalb dieser nichts ändern würde. Ganz im Gegenteil: der Globalisierungsprozess hat prägende Auswirkungen auf die nationalen, regionalen, lokalen Verhältnisse, auf die sozialen und politischen Beziehungen innerhalb dieser. Betrachten wir die Prozesse des soziökonomischen und politischen Wandels in den jeweiligen Gesellschaften – und hier werden wir uns auf die in den Ländern der Dritten Welt beschränken – so ergibt sich folgendes Bild. In der Regel sind Entwicklungsländer ökonomisch und sozial von Disparitäten gekennzeichnet, von asymmetrischer Integration in die Weltwirtschaft, von prekären politischen Systemen. Diese Bedingungen stellen ja gerade die definitorischen Kennzeichen von „Unterentwicklung“ dar. Nicht alle betroffenen Länder sind im gleichen Maße instabil, aber oft haben sie doch Mühe, ein labiles Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Schwankende, tendenziell sinkende Rohstoff- oder Exportpreise allgemein und Belastungen durch Auslandsverschuldung treffen auf einen Kontext schwerster sozialer Probleme (wie Armut, fehlende soziale Infrastruktur, etc.) und eine meist ungleiche, oft autoritäre, diktatorische oder neo-patrimoniale Machtverteilung, in der sich soziale und politische Eliten zuerst um ihre eigenen und oft kaum um die gesamtgesellschaftlichen Probleme kümmern. Häufig sind die Gesellschaften auch sprachlich, ethnisch und religiös sehr heterogen oder fragmentiert, so dass sich politische und wirtschaftliche Konflikte nicht selten in „kulturellen“ Formen ausdrücken und so schwerer lösbar werden. Bereits ohne die Einflüsse der Globalisierung ist ihr Konfliktpotenzial also überdurchschnittlich hoch, zugleich die Fähigkeit eines friedlichen und kooperativen Konfliktmanagements aufgrund der politischen Defizite meist unterentwickelt. Insofern Gesellschaften der Dritten Welt nicht statisch sind und sein können, sondern sich tatsächlich „entwickeln“ (wenn auch nicht unbedingt im Sinne entwicklungspolitischer Zielsetzungen), können solche Prozesse des Wandels das fragile interne Gleichgewicht untergraben oder zum Scheitern bringen. Wirtschaftliche oder soziale Veränderung hat immer machtpolitische Dimensionen, bedroht manche gesellschaftliche Sektoren und nützt anderen. Ähnliches gilt für die verschiedenen Optionen der Bildung moderner Nationalstaaten, die ja explizit oder implizit das Kräftegleichgewicht verschieben und meist auch verschieben sollen: lokale Eliten werden marginalisiert oder an der zentralen Macht beteiligt, Bürokratisierung, Verrechtlichung und andere Formen der Stärkung von Staatlichkeit reduzieren persönliche Loyalitäten und personale oder stammesgestützte Einflussnetze. Wenn bereits in Europa Staatsbildungsprozesse oft von jahrhundertelangen Erschütterungen, von Kriegen oder Fragmentierung früherer Staatswesen geprägt waren, ist dies heute in vielen Ländern der Dritten Welt unter den erschwerten Bedingungen noch wahrscheinlicher. Insofern ist es wichtig, Staatsbildungs- und Nation-Building Prozesse nicht allein als potentiellen Ausweg aus instabilen und krisenhaften Entwicklungen zu betrachten, sondern zugleich als – zumindest mittelfristige – Quellen der Instabilität und Gewaltkonflikte zu begreifen. Ein verrechtlichtes und verregeltes Staatswesen, das das eigene Staatsgebiet wirksam kontrolliert und in akzeptierten Grenzen der Liberalität und des Pluralismus operiert, kann tatsächlich die gesellschaftliche Zersplitterung und das interne Gewaltniveau entscheidend senken. Ein funktionierender Nationalstaat, der nicht allein Minderheiten zum Machtinstrument über andere Gruppen dient, sondern alle relevanten Bevölkerungssektoren einbezieht, kann tatsächlich entwicklungs- und friedenspolitisch nützlich sein. Aber ein im Aufbau begriffener, noch schwacher Staatsapparat, der der Gesellschaft vieles Ungewohnte zumuten muss, ohne bereits seine Vorteile nachweisen zu können oder nur von Teilen der Gesellschaft gegen andere durchgesetzt wird, wird meist zu Unruhe und zusätzlichen Konflikte führen. Der modische Begriff der failed states beruht darauf, die Existenz funktionierender Nationalstaaten als Norm und Selbstverständlichkeit vorauszusetzen, und gescheiterte oder schwer krisenhafte Versuche solcher Staatsbildung als Ursache von Gewalt, Fragmentierung, Ethnisierung und Krieg zu unterstellen – wenn auch oft nur implizit. Dies ist nicht immer zutreffend, da so der oft krisenhafte Charakter von Nationalstaatsbildung bereits als Scheitern interpretiert wird und zugleich die Gefahr besteht, Ursachen und Wirkungen zu verwechseln. In bestimmten Kontexten und unter bestimmten Bedingungen kann ja gerade die Staatsbildung oder ein konkretes Nation-Building Projekt Gewalt fördern oder auslösen oder ethnische Identitäten stärken und so die Fragmentierung erst verfestigen. Die Globalisierung trägt ein Janusgesicht. Sind integriert ökonomische Prozesse auf der globalen Ebene und ruft dadurch entsprechende politische, technologische und kulturelle Folgeprozesse hervor. Zugleich führen dieser Prozess und seine neoliberale Form zu Umstrukturierungen und sozioökonomischem Druck auf praktisch alle Gesellschaften, die zwischen den Gesellschaften und innerhalb ihrer zu Gewinnern und Verlierern führt. Bereits fragile Gesellschaften und prekäre Staaten geraten so besonders unter Druck, und aus schwachen Staaten können so gescheiterte werden. Dabei können failed states dabei entstehen, dass der Staatsbildungsprozess zeitweilig oder dauerhaft stecken bleibt, also ein funktionierender Nationalstaat erst gar nicht zustande kommt, oder indem ein zeitweilig existierender wieder zusammenbricht. Dabei besteht in beiden Fällen meist ein enger Zusammenhang von Staatszerfall und gesellschaftlicher Fragmentierung, wobei sich staatliche Deformationen und Funktionsdefizite in der Regel als kausal bedeutsamer als die gesellschaftlichen Prozesse erweisen und diese noch zuspitzen. Und genau deshalb ist die neoliberale Form des Globalisierungsprozesses für potentielle Krisenherde der Dritten Welt so gefährlich: sie verschärft das gesellschaftliche Konflikt- und Gewaltpotential, verstärkt dadurch die Notwendigkeit politischer und sozialer Integration, die in der Regel vor allem durch den Staatsapparat gewährleistet werden könnten – und reduziert dessen Fähigkeit, solche Integrationsleistungen zu erbringen. Failed states werden in aller Regel durch innergesellschaftliche Probleme und Strukturdefekte verursacht. Aber die Chance, mit solchen friedfertig und integrativ umzugehen, wird durch die neoliberale Globalisierung vermindert.
weitere Texte zu Gewaltkonflikten, Friedens- und Sicherheitspolitik hier
|
| [ Home ] [ zur Person ] [ Bücher ] [ Aufsätze ] [ Texts in English ] [ Fotos ] [ Blog ] |