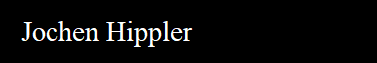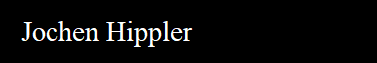|
Jochen Hippler
Die unilaterale Versuchung –
Veränderte Dominanzformen im internationalen System
"Wenn wir handeln müssen, werden wir handeln.
Und wir brauchen wirklich nicht die Zustimmung der Vereinten Nationen, um das zu tun.."
US-Präsident George Bush
Nach dem Ende des Kalten Krieges ist das internationale System durch eine fundamentale Asymmetrie der Macht gekennzeichnet. Die USA als einzig verbliebene Supermacht verfügen heute mit Abstand über die größten Machtpotentiale, vor allem auf militärischem und militärtechnologischem Gebiet, aber auch politisch, ökonomisch und kulturell. Gegengewichte sind nur in Ansätzen zu erkennen, und es wird mindestens zwei Jahrzehnte dauern, bis sich dieses grundlegend ändert. Bis dahin verfügen die USA allein durch ihr Gewicht über eine dominierende Machtposition im internationalen System, was durch eine machtorientierte und selbstbewusste Politik noch forciert werden wird. Auch die von Washington betriebene Militarisierung internationaler Konfliktbearbeitung wird der mit weitem Abstand stärksten Militärmacht weitere Positionsvorteile verschaffen. Seit den 1990er Jahren ist die Welt somit von ausgeprägt unipolarem Charakter – zwar nicht notwendig auf Dauer, aber zumindest für ein oder zwei Generationen. Schlechte Zeiten also für eine multilaterale Politik unter Führung der Vereinten Nationen.
Allerdings sollte man nicht annehmen, die Welt sei vor 1989 allein durch multilaterale Verhältnissen gekennzeichnet gewesen. Die US-amerikanische Außenpolitik bewegt sich zumindest seit dem Ersten Weltkrieg immer in einem Spannungsfeld von Multi- und Unilateralismus. Insofern ist die verstärkt unilaterale Politik der Bush-Administration kein Bruch der Tradition, sondern nur die besondere Betonung eines der beiden grundlegenden Politikansätze der US-Außenpolitik. Wichtig ist allerdings, dass in der praktischen Politik Washingtons kaum jemals der Uni- oder Multilateralismus in reiner Form vorherrschte, sondern es immer nur Akzentverschiebungen zwischen beiden gab.
Zutreffenderweise formulierte Steven Metz in einer Studie für das US Army War College: „Während des Kalten Krieges war die US-amerikanische Außen- und Nationale Sicherheitspolitik niemals rein isolationistisch oder globalistisch, sondern reflektierte ein sich änderndes Gleichgewicht zwischen beidem. Heute ist die angebrachte Mischung erneut der Gegenstand der Diskussion.”
US-Außenpolitik war fast immer zu pragmatisch und zielorientiert, um vom Streben nach ideologischer Reinheit in dieser Frage beherrscht zu werden. Das Mischungsverhältnis zwischen einseitiger und multilateraler Politik mochte wechseln, aber beide Politikstränge existierten und existieren bis heute nebeneinander, oft in harmonischer Ergänzung zur Verfolgung der eigenen Interessen, gelegentlich im Konflikt zwischen einander. Auf diese Weise waren die USA häufig die Vorreiter multilateraler Arrangements (etwa bei der Gründung von Völkerbund, UNO und NATO), andererseits neigten sie ebenso häufig zur Blockade, Schwächung oder Ignorierung multilateraler Mechanismen (etwa bei der Weigerung, dem selbst vorgeschlagenen Völkerbund auch beizutreten, den zahlreichen militärischen Interventionen in Lateinamerika und anderswo, oder bei militärtechnologischen Schlüsselentscheidungen, etwa dem Nationalen Raketenabwehrsystem, das bi- und multilateralen Abrüstungs- und Rüstungskontrollversuchen schweren Schaden zufügte). Der gemeinsame Nenner von uni- und multilateraler Politik bestand häufig darin, multilaterale Strukturen für unilaterale Ziele zu nutzen, also multilaterale Politikinstrumente für die nationalen Interessen zu instrumentalisieren. Solange dies gelang, war auch von konsequenten Unilateralisten in Washington wenig gegen multilaterale Mechanismen einzuwenden.
Die Gründe für diesen Instrumentemix sind historischer Natur. Die USA sind bereits seit dem Ersten Weltkrieg eine Weltmacht, seit dem Zweiten eine „Supermacht“. In der Zeit der Bi-Polarität waren sie allerdings auf Verbündete stärker angewiesen als in der heutigen Phase der Uni-Polarität. Die Sowjetunion war durch unilaterale Macht allein nicht zu bezwingen, ihr „Zurückrollen“ oder ihre „Eindämmung“ basierten außer auf der eigenen wirtschaftlichen und militärischen Macht auf dem Aufbau eines umfassenden Systems von Partnern und Verbündeten, die dieses Interesse teilten und sich von der Kooperation mit den USA Vorteile versprachen. In bi- oder multilateralen Systemen können Völkerrecht und andere Regelmechanismen, also multilaterale Politikansätze, notwendig sein, um Konflikte einzuhegen und zu regulieren. Auf diese Weise vermögen sie unter bestimmten Bedingungen den nationalen Eigeninteressen zu dienen, indem sie etwa Risiken vermindern oder zumindest berechenbarer machen. Multilaterale und kooperative Politikformen sind in komplexen bi- und multilateralen Kontexten sinnvoll, weil sie die Organisierung des eigenen „Lagers“ gegen den Gegner erlauben und ihn so zu schwächen befähigen, zugleich aber den Antagonismus zu dem oder den Gegnern teilweise unter Kontrolle halten. Da keine Seite der anderen ihre Eigeninteressen als allgemeine Regel aufzuoktroyieren vermag, bleibt kaum etwas anderes, als solche Regeln multilateral auszuhandeln und völkerrechtlich zu kodifizieren.
Nach dem Ende des Kalten Krieges sind die globalen Machtverhältnisse vorläufig geklärt. Die USA haben eine beherrschende Machtstellung im internationalen System erreicht, die von keinem anderen Akteur in frage gestellt werden kann. Damit werden der Anreiz und die Notwendigkeit für Kooperation und Multilateralismus vermindert. Multilateralismus, Völkerrecht und andere Formen der Selbsteinbindung erscheinen so weniger als Chance kooperativer Problemeinhegung und Problemlösung, sondern als Hindernis eigener Interessendurchsetzung und Machtentfaltung. In der US-Außenpolitik wird so die unilaterale Politikströmung gestärkt, da ihre Plausibilität und ihr Realitätsbezug gestiegen sind. Unilateralismus – nicht in Reinform, sondern als Grundtendenz – ist heute zu einer realistischen Option US-amerikanischer Politik geworden, während dies früher nur in Ansätzen und Teilbereichen (etwa bezogen auf Mittelamerika und die Karibik) der Fall war.
Die unilaterale Versuchung
Dieser Tatbestand bedeutet zweierlei nicht: einmal bestreitet er nicht, dass es weiterhin Anreize zu multilateralen Verhaltensweisen und Politikinitiativen geben kann und dass die US-Regierung nicht auch zukünftig multilaterale Aktivitäten entfalten wird. Zweitens bedeutet die Argumentation auch nicht, dass die USA als solche das Problem wären, dass es etwa an deren spezifischem Charakter oder den Besonderheiten ihrer Außenpolitik läge. Steven Holloway bringt den Tatbestand rückblickend auf den Punkt: „Großmächte verließen sich auf ihren eigenen Machtvorsprung, kleinere Mächte auf das Völkerrecht und Internationale Organisationen. Einfach ausgedrückt: Großmächte tendierten zum Unilateralismus, kleine und mittlere Mächte zum Multilateralismus.”
Tatsächlich handelt es sich bei unserem Problem nicht um die US-Politik also solche, sondern um die Struktur der internationalen Beziehungen: einseitige, überwältigende Dominanz lädt Großmächte zu unilateralen Maßnahmen, imperialem Verhalten und Arroganz ein – unabhängig davon, wer eine solche Machtposition innehat. Und die USA sind heute nicht nur eine große Macht unter anderen, sondern die einzige Weltmacht. Würde ein anderes Land im gleichen Maße dominieren, wären kaum andere Verhaltensweisen zu erwarten, wie viele historische Erfahrungen nahe legen. Dies ändert allerdings nichts daran, dass gerade diese einseitige Machtverteilung heute eines der Schlüsselprobleme im internationalen System darstellt – und dass die USA zurzeit der Staat sind, der sich der Dominanz erfreut, ihre Chancen nutzt und ihren Versuchungen erliegt.
„Amerikanischer Internationalismus“?
Der neue US-Unilateralismus, insbesondere der geringschätzige Umgang mit internationalen Verträgen und den Vereinten Nationen, wird auch in den USA zunehmend diskutiert. Ein schönes Beispiel war eine Pressekonferenz des Präsidentensprechers Ari Fleischer im Juli 2001. Eine Journalistin stellte die pointierte Frage: “Gibt es irgendeinen Vertrag seit dem Zweiten Weltkrieg, den diese Regierung nicht kaputtmachen möchte? (Gelächter.)”
Der sich entwickelnde Dialog zwischen Fleischer und der Journalistin ist so unterhaltsam wie aufschlussreich:
“Ari Fleischer: Denken Sie an etwas Bestimmtes?
Journalistin: Es sieht so aus, als ob Sie jeden Vertrag, der in den letzten 25 Jahren zustande gekommen ist, ablehnen und zerreißen möchten. Hat denn nichts Geltung, das vor Íhrem Amtsantritt beschlossen wurde?
Ari Fleischer: … Lassen Sie mich Ihre Frage beantworten. Es hat eine Reihe von Fragen gegeben, bei denen der Präsident amerikanische Führungskraft demonstriert, weil er mehr daran interessiert ist zu tun, was richtig für Amerika ist und dass Amerika die Welt zu guten Lösungen zu schwierigen Fargen führt. … Der Präsident wird Amerika weiterhin in den internationalen Beziehung auf der Basis dessen führen, was richtig und was gut für Amerika ist. Das ist ein entschieden Amerikanischer Internationalismus.
Journalistin: Ich habe eine Zusatzfrage. Wie kann man führen, wenn man keine Freunde oder Verbündete mehr hat, die mit uns in irgendeiner Frage übereinstimmen?
Ari Fleischer: Ich denke die Frage ist, warum sollten die Vereinigten Staaten bezüglich der Frage des B-Waffen-Protokolls zustimmen …
Journalistin: Führerschaft muß andere überzeugen.
Ari Fleischer: … wenn dieses Protokoll so leicht umgangen werden kann, daß der Iran gerne unterschreibt?
Journalistin: Ari, was ist der Unterschied von entschiedenem Internationalismus und Isolationismus?
Journalist: Ja, zur gleichen Frage hätte ich eine Ergänzung. Manche sagen, dass die Politik zu diesen verschiedenen Verträgen eine Art neuen Unilateralismus in der amerikanischen Außenpolitik demonstriert. Was würden Sie darauf antworten?
Ari Fleischer: Nun, ich denke, wenn Sie sich die Reisen des Präsidenten nach Europa ansehen, werden erkennen, in welchem Maße der Präsident Europa führt und gut mit unseren europäischen Verbündeten zusammenarbeitet. … Die Treffen des Präsidenten mit Präsident Putin legen nahe, daß Präsident Putin und Präsident Bush gut zusammenarbeiten, um die Welt zu einer neuen Vision zu führen, wie man den Frieden bewahrt. Wenn das nicht die Definition von Multilateralismus ist, dann weiß ich nicht, worin sie besteht. Die Vereinigten Staaten werden unter Präsident Bush weiterhin gut mit unseren Verbündeten und Partnern in der Welt zusammenarbeiten. Aber der Präsident wird sich nicht vor seiner Pflicht drücken, das amerikanische Volk vor jeder internationalen Übereinkunft zu schützen, von der der Präsident glaubt, daß sie nicht im amerikanischen Interesse liegt.”
Offensichtlich handelt es sich hier um eine besondere Spielart des „Multilateralismus“.
Dem US-Präsidenten geht es, wie jüngst der Irak-Krieg bewiesen hat, vor allem um „die Demonstration amerikanischer Führung“, da er „am meisten daran interessiert ist, was gut für Amerika ist und Amerika die Welt führen lässt“. Der Präsident wird seine Politik weiterhin auf der Basis dessen führen, was „richtig und am besten für Amerika“ ist. Dies sei, so Fleischer, ein „entschiedener amerikanischer Internationalismus“. Der US-Präsident betrachtet es als seine „Pflicht“, das „amerikanische Volk vor allen internationalen Abkommen zu schützen, die er nicht für im amerikanischen Interesse hält“.
Eine Grundüberzeugung für multinationale Politikformen lässt sich aus solchen Positionen kaum herauslesen. Während es selbstverständlich ist, die eigenen Interessen zu berücksichtigen und zum Ausgangspunkt eigener Politik zu machen, werden hier die eigenen Interessen denen anderer Staaten und den globalen Notwendigkeiten gerade entgegengesetzt. Statt beide in Übereinstimmung zu bringen, wird der US-amerikanische Führungsanspruch gegenüber unliebsamen internationalen Abkommen formuliert.
Selektiver und imperialer Multilateralismus
Durch die dominierende Rolle Washingtons im Weltsystem kommt dessen instrumenteller und oft destruktiver Politik gegenüber multilateralen Mechanismen eine eminente Bedeutung zu. Unilateralismus einer Welt- und Supermacht ist nicht nur wahrscheinlicher als die von kleineren Mächten, sondern auch prägender. Ein kooperativer Multilateralismus kann die globale Hegemoniemacht kaum aussparen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Die entscheidende Frage lautet demnach: Welche Formen von Multilateralismus und Unilateralismus werden die Zukunft dominieren? Auch die Bush-Administration ist nämlich keineswegs per se gegen Multilateralismus. Im Gegenteil: wenn die US-Regierung ihre wahrgenommenen Eigeninteressen mit Zustimmung oder durch Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft erfolgreich durchsetzen kann, wird man dies in der Regel auch versuchen. Gegen einen Multilateralismus kann so lange selbst von Seiten eingefleischter Unilateralisten nichts einzuwenden sein, wie er den eigenen Interessen dient. Deshalb darf bei der Unterscheidung von Multi- versus Unilateralismus nicht davon ausgegangen werden, dass sich in der Realität beide Formen idealtypisch gegenüberstehen. Vielmehr ist eine zweite Unterscheidung von großer Bedeutung: erfolgen multilaterale Maßnahmen zwischen prinzipiell Gleichen, wobei jede Seite prinzipiell ihre Sichtweisen und Interessen einbringen kann – oder nutzt eine Hegemon seine Machtstellung, um andere zur Gefolgschaft zu nötigen und seine unilaterale Sicht multilateral zu verhüllen oder durchzusetzen? Dann existieren möglicherweise bloß formale Mechanismen des Multilateralismus ohne multilaterale Substanz. Ein solcher instrumenteller Multilateralismus stellt unter Umständen kaum mehr dar, als eine weitere Dominanzform des Hegemon. Die Unterscheidung von Multilateralismus versus Unilateralismus ist also nicht einfach bipolar strukturiert, sondern sie verläuft in graduellen Differenzen, über ein Kontinuum verschiedener Abstufungen. In einem ersten Grobraster lassen sich folgende Kategorien unterscheiden:
- „kooperativer Multilateralismus“ zwischen prinzipiell Gleichen;
- „selektiver Multilateralismus“, bei dem kooperativer Multilateralismus punktuell oder auf einzelnen Politikfeldern angewandt wird, wenn dies den unilateral definierten Eigeninteressen nutzt;
- „imperialer Multilateralismus“, bei dem die Form des Multilateralismus teilweise oder zum Schein gewahrt wird, multilaterale Mechanismen aber vor allem zu Dominanzzwecken eingesetzt werden und die „Kooperation“ unilaterale Machtverhältnisse und Politiken maskiert;
- „regionaler Unilateralismus“, bei dem in bestimmten Regionen oder in Bezug auf bestimmte Länder rein unilateral agiert wird (historisch etwa Mittelamerika und die Karibik), während in anderen Regionen stärker multilaterale Politikformen angewandt werden (z.B. bezüglich Westeuropas);
- „reiner Unilateralismus“, bei dem multilaterale Mechanismen ignoriert; und
- „offensiver Unilateralismus“, bei dem multilaterale Mechanismen bewusst untergraben, geschwächt oder sabotiert werden.
Tatsächlich ist die Politik Washingtons nicht erst seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Antritt der Bush-Administration imperial angelegt – aber nicht automatisch und immer unilateral. Es handelt sich vielmehr um eine flexible Anwendung der Punkte 2-6 des skizzierten Spektrums: je nach Nutzen wird mal das eine, dann ein anderes Instrument der Interessenpolitik betont. Man kann also von einem flexiblen, selektiven Unilateralismus sprechen, mit einer Tendenz zu Formen des reinen und offensiven Unilateralismus.
Wie in einem Brennglas verdichtet sich dieser Tatbestand in der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie, die Präsident George Bush im September 2002 verkündete. Dort findet sich in schöner Klarheit die Ausführung: „Während die Vereinigten Staaten immer danach streben werden, sich der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft zu versichern („to enlist the support“) , werden wir nicht zögern, nötigenfalls allein zu handeln, um unser Recht auf Selbstverteidigung auch durch prä-emptives Handeln wahrzunehmen....“.
Die Formulierung “to enlist” bedeutet “anwerben“ (durchaus mit militärischer Konnotation), also keine gleichberechtigte Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft, sondern deren Nutzung als politische oder militärische Hilfstruppe für die US-Politik, was der realen Praxis Washingtons durchaus entspricht. Falls dies nicht möglich ist, handelt man allein – und zwar gegebenenfalls in „präemptiver Selbstverteidigung“, also vorbeugend, bevor eine Bedrohung erst entstehen kann. Was kaum mehr als eine höfliche Formulierung der alten Weisheit ist, nach welcher Angriff die beste Verteidigung sei. In der Nationalen Sicherheitsstrategie findet sich die erhellende Formulierung, dass die Regierung „anerkennt, dass Angriff unsere beste Verteidigung ist“ („that our best defense is a good offense“).
So wird das Völkerrecht dem nationalen Eigeninteresse untergeordnet: „präemptive Verteidigung“ ist dem Völkerrecht nicht nur fremd, sondern ein Völkerrechtsbruch. Völkerrechtlich kann das „Selbstverteidigungsrecht“ (gemäß Artikel 51 der UNO-Charta) bekanntlich nur die Abwehr eines im Gange befindlichen oder unmittelbar bevorstehenden Angriffs bedeuten. Dies aber ist das Gegenteil von Präemption.
Die konservative Neue Zürcher Zeitung stellte in Bezug auf die US-Irakpolitik nüchtern fest: „Anders als in Europa spielt auch das Völkerrecht in der Debatte kaum eine Rolle. Selbst die Anhänger eines multilateralen Vorgehens geben routinemäßig zu Protokoll, dass der UNO – sprich den Franzosen, Russen oder Chinesen – kein Vetorecht in Fragen der nationalen Sicherheit Amerikas zustehe. Ein breit abgestütztes Vorgehen wird vielmehr aus pragmatischen Gründen gefordert: Verbündete sind nötig, um Saddam Hussein international zu isolieren, um Stützpunkte und Lufträume benutzen zu können, um einer amerikanischen Präsenz im Zweistromland größere Legitimation zu geben und, nicht zuletzt, um die Kosten aufzuteilen.“
Die Folgen liegen auf der Hand: “Wenn ein mächtiges und einflußreiches Land wie die Vereinigten Staaten seine rechtlichen Verpflichtungen nur dann beachtet, wenn es ihm paßt oder es seinen nationalen Interessen entspricht, werden andere Staaten das als Rechtfertigung betrachten, ihren eigenen Verpflichtungen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr nachzukommen. Wenn die Vereinigten Staaten möchten, dass ein anderes Land sich an seine vertraglichen Verpflichtungen hält, könnten sie feststellen, daß dieses Land dem US-Beispiel gefolgt ist und sich für eine Nicht-Einhaltung der Regeln entschieden hat.”
Die Kombination aus selektivem und imperialem Multilateralismus mit verschiedenen Schattierungen des Unilateralismus durch Washington bedeutet deshalb zweierlei: einmal die Schwächung einzelner multilateraler Problemlösungsversuche, aber auch die Schwächung des Systems und der Legitimität des kooperativen Multilateralismus, welcher auf die Mitarbeit der wichtigen Politikakteure angewiesen ist. Wenn der Hegemon Multilateralismus nicht prinzipiell, sondern nur a` la carte, sprich: nach Geschmack und konkreten nationalen Nutzen im Einzelfall, praktiziert , schafft er einen idealen Präzedenzfall für andere Länder , das Völkerrecht ebenfalls zu ignorieren oder zu relativieren.
Gegenstrategien
Teilweise wird von Regierungen und anderen internationalen Akteuren als Gegenstrategie versucht, Washington durch materielle Zugeständnisse in der Sache dazu zu bringen, seine Politik im Rahmen der NATO, der UNO und des Völkerrechts zu verfolgen. Die UN-Resolution 1441 zum Irak stellte ein Beispiel dieser Politik dar. Um Washington im Herbst und Winter 2002/2003 daran zu hindern, unilateral und unter Ignorierung der UNO den Irak militärisch anzugreifen, stellte der UN-Sicherheitsrat Bagdad ein etwas unklar formuliertes Ultimatum. Solche Taktik erweist sich allerdings als zwiespältig: sie vermag Zeit zu gewinnen, aber die US-Administration nicht von ihrem Kurs abzubringen. Es handelt sich leicht um einen Kuhhandel, bei der man der unilateralen Substanz der US-Politik weit entgegen kommt, um die multilaterale Form eine Zeit lang zu retten – bis zu dem Punkt, an dem sich Washington durch den partiellen Multilateralismus zu stark gebunden fühlt und ihn schließlich doch fallen lässt. Dann aber hat die internationale Gemeinschaft eine Reihe der politischen Prämissen Washingtons bereits akzeptiert und diesen teilweise Legitimität verschafft, die sie zuvor nicht hatten. Ähnlich sieht es mit den Versuchen aus, die NATO als multilateralen Rahmen zu nutzen, wenn die UNO Washington zu unbequem erscheint. Dabei kann die Zustimmung eines Militärbündnisses einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates keinesfalls ersetzen – sie soll aber den Eindruck größerer Legitimität erwecken. Völkerrechtsverstöße werden so nicht vermieden oder aufgehoben, sondern die NATO-Verbündeten zahlen für die „multilaterale Einbindung“ Washingtons in NATO-Entscheidungen den Preis, selbst an den evtl. Völkerrechtsbrüchen teilzuhaben.
Anders ausgedrückt: im Extremfall besteht der Preis für die multilaterale Einbindung Washingtons in der Übernahme seiner Positionen – dann spricht auch aus Bushs Perspektive nichts gegen Multilateralismus. Als bloßer Formalakt verliert der Multilateralismus aber gerade seinen Sinn: anstatt den Hegemon „einzubinden“ und auf die Regeln des Völkerrechts und internationaler Organisationen zu verpflichten, werden beide nur zu einem weiteren Machtinstrument der Supermacht. Damit ist nicht nur nichts gewonnen, sondern die Substanz eines kooperativen Multilateralismus wird seinem Schein geopfert. Ein derart sinnentleerter Multilateralismus ist nicht nur entbehrlich, sondern stellt eine zusätzliche Gefahr der „Vermachtung“ der internationalen Beziehungen dar.
Gegen solche Instrumentalisierung multilateraler Politikformen einzutreten, ist so dringlich wie schwierig. Kurzfristig kann eine solche Politik kaum Erfolge versprechen, da die nötige Einhegung von Hegemonialstaaten keine Frage des politischen Willens allein, sondern vor allem der Machtverhältnisse ist. Und diese sind gegenwärtig so eindeutig, dass ein offenes Entgegentreten nur punktuell realistisch ist, wie man an zentralen Punkten und mit Einschränkungen im Fall des Irak beobachten konnte. Eine Politik des Gleichgewichts zur Erhöhung des politischen Spielraums fast aller Akteure und der Schaffung wichtiger Voraussetzungen für kooperativen Multilateralismus setzt letztlich Staaten oder Staatensysteme mit entsprechendem Gewicht voraus. Um dem unilateral geprägten Hegemon mit geschlossenen Gegenentwürfen entgegentreten zu können, fehlt derzeit die nötige Machtbasis. Zumindest in diesem Jahrzehnt wird es deshalb um nicht mehr gehen können, als um eine defensive Politik zur Sicherung des erreichten Niveaus an Verrechtlichung und Multilateralisierung, darum, die Transformation der bestehenden Elemente von kooperativem Multilateralismus in eine imperiale Spielart zu hintertreiben und das Völkerrecht vor seiner Aushöhlung so gut es geht zu schützen. Auf dieser Basis wird es sicher möglich sein, von Zeit zu Zeit punktuell zusätzliche Pflöcke eines kooperativen Multilateralismus einzuschlagen, wenn sich aufgrund besonderer Umstände eine solche Chance ergeben sollte. Schließlich wird es auch punktuell möglich sein, die Kosten unilateraler oder imperialer Politik für den Hegemon zu heben und so ihre Umsetzung graduell zu mäßigen. Viel mehr dürfte für das nächste Jahrzehnt nicht zu erwarten sein.
Quelle:
Blätter für deutsche und internationale Politik, Juli 2003, S. 818-825
bei diesem Text handelt es sich um eine bearbeitete und gekürzte Fassung von:
US-Dominanz und Unilateralismus im internationalen System - Strategische Probleme und Grenzen von Global Governance,
in: Jochen Hippler/Jeanette Schade, US-Unilateralismus als Problem von internationaler Politik und Global Governance, INEF-Report 70, Juli 2003, am Institut für Entwicklung und Frieden (INEF), Duisburg
|