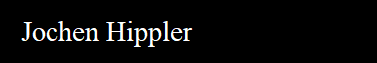

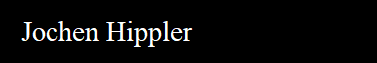 |
 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Jochen Hippler Militärische Besatzung als Schöpfungsakt –
Auch die Kurden sind keine geschlossene Einheit: in der nördlichen (nach dem Golfkrieg 1991 eingerichteten) Autonomiezone kam es Mitte der 1990er Jahre zu einem Krieg der beiden wichtigsten Parteien, der zur Entstehung zweier, offiziell nicht anerkannter kurdischer Kleinstaaten führte. Die bis zu einer Million Kurden in Bagdad sind meist schiitischen Glaubens, während die im kurdischen Kernbereich lebenden in der Regel Sunniten sind. Die politischen Strukturen des Irak waren seit der Staatsgründung schwach, zuerst auch anachronistisch: im Wesentlichen von arabischen Sunniten beherrscht, deren Herrschaft von Großgrundbesitzern und anderen Machteliten getragen war. Selbst der irakische König merkte einmal an, dass sein Land eigentlich unregierbar sei. Faisal I. formulierte 1933 in einem vertraulichen Memorandum: „Es gibt noch – und das sage ich mit einem Herzen voller Traurigkeit – kein irakisches Volk, sondern unvorstellbare Massen von Menschen, ohne jede patriotische Idee, sondern voller religiöser Traditionen und Absurditäten, durch kein gemeinsames Band verbunden, die auf das Böse hören, zur Anarchie neigen und immer bereit sind, gegen jede beliebige Regierung aufzustehen.“ (zit. n. Batatu 1982, 25) Die Jahre 1958-68 waren eine Periode großer Instabilität: der Revolution folgte ein Jahrzehnt der Putsche und Gegenputsche und eine erste Welle des kurdischen Aufstandes. Der Irak war bis zu diesem Zeitpunkt noch keine „Nation“, sondern eine Verknüpfung heterogener sozialer und ethno-religiöser Subsysteme, die durch einen unzureichend gefestigten Staatsapparat notdürftig zusammengehalten wurden. Der Krieg gegen den Iran (1980-88) und die Eroberung Kuwaits (1990) gehörten in diesen Zusammenhang: der Konkurrent Iran sollte zu einem Zeitpunkt der Schwäche (nach der islamischen Revolution) schnell niedergeworfen und ausgeschaltet, ihm möglichst noch die ölreiche Provinz Khusistan (mit seiner arabischen Minderheit) entrissen werden. Die Eroberung Kuwaits hätte dem Irak nicht nur weitere, beträchtliche Ölfelder eingebracht, sondern auch seine kriegsbedingten Auslandsschulden drastisch vermindert und dem Land einen leistungsfähigen Hafen am Persischen Golf verschafft. In beiden Fällen schlugen diese machtpolitischen Kalkulationen allerdings fehl: den Krieg gegen den Iran gewann man zwar nach schweren Rückschlägen und großen Anstrengungen, aber das Land war durch die beträchtlichen Verluste an Menschen, Infrastruktur und seine kriegsbedingte Verschuldung in höchstem Maße geschwächt. Die Niederlage im Golfkrieg (1991) gegen eine breite Koalition unter Führung der USA mit den auf ihn folgenden, bis zum Irakkrieg 2003 dauernden internationalen Sanktionen zerrütteten das Land vollständig. Aus einem wohlhabenden Ölland der späten 1970er Jahre wurde vor der Jahrtausendwende ein großer Slum mit Wohlstandsinseln. Das ursprüngliche Rezept der Baath-Diktatur, durch eine Kombination sozialpolitischer, wirtschaftlicher und infrastruktureller Wohltaten mit brutaler Unterdrückung Stabilität zu erreichen, den Irak zu einem Starken Staat und internationalem Machtfaktor zu machen und insgesamt ein erfolgreiches Projekt des arabischen Nation-Building zu bewältigen, war spätestens in den 1990er Jahren gescheitert. Von der Mischung aus Geld und Unterdrückung blieb allein die letztere, um das Regime zu retten. Ein Ergebnis dieser Entwicklung war, dass die irakische Gesellschaft (mit der unten behandelten Ausnahme des kurdischen Autonomiegebietes im Norden) politisch erstickte, jede politische Arbeit außerhalb der Diktatur erstarb oder ins Exil abgedrängt und der Zusammenhalt der irakischen Gesellschaft massiv geschwächt wurde. Die verschiedenen Elemente der Gesellschaft wurden fast nur noch durch die Diktatur zusammengehalten, alle anderen politischen Integrations- und Artikulationsmechanismen unterdrückt oder zerschlagen.
Eine kurdische Eigenstaatlichkeit und Nation-Building wurde so durch die eigene Zerstrittenheit, durch die Regierung in Bagdad und die Drohungen der Nachbarländer vereitelt, während diese Faktoren die gemeinsame Identität und das Streben der Bevölkerung nach Unabhängigkeit noch stärkten. Als nach dem Golfkrieg 1991 allerdings im Norden des Irak eine Schutzzone der Kurden gegen Saddam Hussein eingerichtet wurde (in der etwa 60 % der irakischen Kurden lebten), kam es zur Bildung eines (dann zweier) kurdischer Proto-Staaten, die bis 2003 über eigene Regierungen, eigenes Militär, ein eigenes Parlament und eine eigene Währung verfügten und faktisch unabhängig waren, wenn auch die völkerrechtliche Anerkennung fehlte. Diese Tatsache unterstreicht nachdrücklich das Scheitern des baathistischen Nation-Building Projektes, das ja den Gesamtirak zu einem arabischen Nationalstaat zu machen gedachte.
Die Ausgangslage eines neuen Anlaufs von Nation-Building im Irak stellte sich nach dem Krieg als sehr schwierig dar. Die bisher das Land dominierende Gruppe sunnitischer Araber (bzw. eines Teils dieses Bevölkerungsteils) musste nun fürchten, entscheidend an Einfluss zu verlieren. Sie war in geringerem Maße von der Diktatur unterdrückt worden, vor allem aus ihr rekrutierten sich die meisten Kader oder Unterstützer, und sie hatte wirtschaftlich und politisch am ehesten Nutzen aus der Herrschaft Saddam Husseins gezogen. Eine solche privilegierte Position war für die Zukunft ausgeschlossen, so dass die Unzufriedenheit mit der neuen Ordnung hier am größten und am schnellsten vorhanden war. Zugleich verfügten die sunnitischen Araber (bzw. arabischen Sunniten, je nach Selbstdefinition) über keine handlungsfähige Führung, kaum über politische Organisationen. Diese Bevölkerungsgruppe war zersplittert, führungslos und politisch kaum handlungsfähig, was das Gefühl der Ohnmacht noch verstärkte. Bei „den“ Schiiten stellte sich die Situation anders dar. Trotz ihrer Bevölkerungsmehrheit waren sie unter Saddam (und in den Jahrzehnten zuvor) von der Macht weitgehend ausgeschlossen geblieben und hatten – wie die Kurden – besonders unter der Brutalität der Diktatur gelitten. Nun konnten sie damit rechnen, eine insgesamt dominierende Position einzunehmen, wenn sie den anderen Gruppen gegenüber geschlossen auftraten. Die Ausgangsposition der schiitischen Araber (bzw. arabischen Schiiten; die Sonderrolle der schiitischen Kurden im Großraum Bagdad lassen wir hier unberücksichtigt) war dadurch gekennzeichnet, dass ihre politischen Organisationen zwar von der Diktatur schwer getroffen und massiv unterdrückt worden waren, deren religiös inspirierte Parteien aber im Exil (und in geringerem Maße im Untergrund) noch existierten. Diese verfügten daher beim Sturz der Diktatur über einen wichtigen politischen Vorsprung: bei ihrer Rückkehr aus dem Iran konnten sie schnell über eingespielte politische Strukturen, Geld, und eigene bewaffnete Milizen verfügen. Demgegenüber war der säkulare Flügel schiitischer Araber (eigentlich mit starkem Potenzial) fast unorganisiert und deshalb politisch kaum handlungsfähig. Die früher bedeutende Kommunistische Partei, die von Saddam brutal zerschlagen worden war, bemühte sich um Reorganisation, litt aber an Geldmangel und fehlender ausländischer Unterstützung, über die die religiösen Parteien der Schiiten verfügten. Deshalb war die Politik der schiitischen Araber, trotz beträchtlicher säkularer Instinkte, eindeutig religiös strukturiert. Innerhalb des religiösen Sektors kam es darum zu besonders massiver Konkurrenz zwischen den Parteien und Strömungen, sowie zwischen den deutlichen iranischen Einflussnahmen und dem Bestehen auf einer „irakischen“ Interpretation der Schia. Bei der kurdischen Bevölkerung, insbesondere in der kurdischen Autonomiezone, sah die Lage grundlegend anders aus als im Rest des Landes. Hier bestanden weiterhin funktionierende politische Strukturen (die beiden dominierenden Parteien und ihre protostaatlichen Regierungsinstanzen) und eine weitgehend intakte Infrastruktur, die in der Zeit seit 1991 aufgebaut worden war. Mittelfristig ist zwar mit einer Umgestaltung der politischen Landschaft in irakisch Kurdistan zu rechnen, da die Unzufriedenheit großer Teile der Bevölkerung mit Korruption, Vetternwirtschaft und diktatorischem Gehabe der beiden Parteien beträchtlich ist und nach dem Sturz der Saddam-Diktatur weiter wächst. Ob dies zu einer „dritten Kraft“ jüngerer und modernerer Kräfte oder zu einer grundlegenden Reform von KDP und PUK führen wird, ist noch nicht absehbar, aber trotz dieses Unsicherheitsfaktors waren die Stabilität und politische Handlungsfähigkeit des kurdischen Autonomiegebietes hoch, insbesondere im Vergleich zum Rest des Landes. Allerdings besteht in der kurdischen Bevölkerung und in ihren Parteien eine massive Stimmung zugunsten der Unabhängigkeit vom Irak, die aus pragmatischen Gründen allerdings nicht öffentlich gefordert wird. Die kurdische Politik drängt deshalb stark auf eine Föderalisierung des Irak und ihre faktische Autonomie als Mindestbedingungen eines Verbleibens im Irak, die bei einem unbefriedigenden Verlauf dann zur Eigenstaatlichkeit ausgebaut werden könnten. Zugleich bestehen starke Tendenzen die kurdischen Siedlungsgebiete außerhalb der alten Autonomiezone in den kurdischen Machtbereich zu integrieren, und die wichtige Ölstadt Kirkuk und die Umgebung von Mosul zu (re-)kurdisieren, was beträchtliches Konfliktpotenzial gegenüber arabischen und turkmenischen Bevölkerungsteilen birgt.
„Garner arbeitete eng mit Rumsfeld und Feith zusammen und traf sich einmal in der Woche mit der Nationalen Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice. Nur sieben Wochen vor dem Krieg konnte man Garners Mitarbeiter noch an den Fingern einer Hand abzählen, aber schließlich rekrutierte er einen Stab aus verschiedenen Behörden. … Im März (2003), nachdem Garner in Kuwait eingetroffen war, glaubten Mitglieder seines eigenen Teams, dass die Regierung sowohl die Amerikaner als auch die Irakis schlecht auf das vorbereitet hatte, was nun kommen würde. Ein US-Beamter erinnerte sich: ‚Meine uniformierten Freunde sagten mir immer ‚Wir sind nicht vorbereitet. Wir gehen in den Rachen der Bestie’.’“ (Washington Post 2003a). Die Nachkriegsplanung war nicht allein von bürokratischen Kämpfen, Personalmangel und Improvisation gekennzeichnet, sondern beruhte auch auf Fehleinschätzungen. So unterstellte man, dass die irakische Bevölkerung die US-Truppen begeistert und „mit Blumen“ begrüßen würde. Auch deshalb erklärte Garner seinen Mitarbeitern, sie sollten sich „innerhalb von 90 Tagen“ im Irak überflüssig machen (Washington Post 2003b). Die Passivität und mangelnde Vorbereitung der Besatzungsbehörden trugen dazu bei, dass sie viele drängende Aufgaben nicht oder sehr ungenügend bewältigte. Ein Indiz dieses Scheiterns war die schnelle Ablösung Jay Garners durch Paul Bremer. Dabei meinte das Pentagon – in offenem Konflikt mit dem Außenministerium und der CIA – vor allem Ahmed Chalabi, der über enge persönliche Beziehungen zu Vizepräsident Cheney, Verteidigungsminister Rumsfeld und anderen verfügte, auf den Schild heben zu können. Die Vorstellung, den irakischen Staatsapparat zu erhalten und nur mit einer neuen, handverlesenen Spitze zu versehen, erwies sich allerdings schnell als unrealistisch: die Behörden lösten sich praktisch über Nacht auf, die Polizisten blieben zuhause, und Chalabi wurde von der irakischen Bevölkerung höchst ablehnend aufgenommen. Nachdem die schnelle Übergabe der Macht an eine Gruppe genehmer Exilanten früh gescheitert und der Staatsapparat kaum noch vorhanden war, stellte sich die Aufgabe von State- und Nation-Building von selbst: um die praktischen Probleme einer Gesellschaft von 24 Mio. Einwohnern zu bewältigen, war ein funktionierendes Staatswesen unverzichtbar, nicht zuletzt um die Bevölkerung kontrollieren und Sicherheit gewährleisten zu können. Und die ungefestigten Verhältnisse innerhalb und zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen erforderten politische Integrationsmechanismen, die erst geschaffen werden mussten. Diese Aufgaben wurden dadurch wesentlich erschwert, dass sich die Lebensbedingungen im größten Teil des Landes (außer der kurdischen Autonomiezone) unter dem Besatzungsregime massiv verschlechterten: die Sicherheitslage spitzte sich sofort dramatisch zu, wie die Welle der Plünderungen in vielen Städten deutlich machte. In diesem Zusammenhang spielten die US-Truppen eine höchst zweifelhafte Rolle: in vielen Fällen weigerten sie sich trotz nachdrücklicher Bitten, selbst Krankenhäuser oder das Nationalmuseum vor Plünderern zu schützen, in anderen Fällen berichteten Augenzeugen, dass sie Plünderungen sogar ermutigten. So wurde die deutsche Botschaft in Bagdad erst geplündert, nachdem ein US-Panzer das Tor niedergewalzt und US-Soldaten die Täter ermutigt hatten. Die ersten beiden Aufgaben, deren Erfüllung notwendig war, um das Land kurzfristig zu stabilisieren, die Besatzung zu legitimieren und Voraussetzungen für Kontrolle und Nation-Building zu schaffen, wurden mit erstaunlicher Hilflosigkeit angegangen. Die Sicherheit der eigenen Truppen konnte nur mit großen Einschränkungen hergestellt werden: schon im Sommer 2003 waren mehr US-Soldaten bei Anschlägen getötet worden, als während des Krieges. Politisch noch bedeutsamer war allerdings die Tatsache, dass die irakische Zivilbevölkerung noch weit weniger sicher war als die Besatzer: Spontane und organisierte Gewaltkriminalität, politische Einschüchterung und Gewalt sowie allgemeine Rechtlosigkeit entwickelten sich zu einer täglichen Bedrohung der Zivilbevölkerung. Häufig wurde deshalb die Kritik vorgetragen: „Die US-Truppen sind sehr an Sicherheit interessiert – aber nur an ihrer eigenen, nicht an unserer.“ Auch die Wiederherstellung ziviler Infrastruktur verlief erstaunlich schleppend und in den ersten Monaten erfolglos: die Stromversorgung funktionierte in Bagdad nur 7-8 Stunden am Tag, in Städten wie Mosul nur 2-4 Stunden, so die Beschwerden von Einwohnern. Ohne Elektrizität sind andere öffentliche Dienstleistungen eingeschränkt: So gibt es ohne Strom vielerorts keine Wasserversorgung, weil die Pumpen nicht funktionieren. Gerade bei großer Hitze (im Sommer 2003 bis zu 60 °C) haben solche Einschränkungen direkte Auswirkungen auf die Gesundheitssituation – gerade unter Umständen, in denen auch die medizinische Versorgung nur notdürftig funktioniert. Ein hoher US-Beamter erläuterte das Problem Anfang Juli folgendermaßen: Die Kritik an den schweren Mängeln in den Bereichen Sicherheit und Infrastruktur war bereits im Sommer 2003 (außerhalb der besser organisierten kurdischen Autonomiezone) allgemein, Unterschiede bestanden vor allem in deren politischer Bewertung: ein Teil der Bevölkerung plädierte für Geduld, andere verlangten zunehmend lautstark den Abzug der Besatzungstruppen und Verantwortung für irakische Stellen. Auch bei der Einführung neuer gesellschaftlicher und politischer Integrationsmechanismen und des state-building wurden schon bald schwerwiegende Probleme erkennbar. So wurden einerseits entgegen den ursprünglichen Planungen durch den US-Zivilverwalter Paul Bremer noch 15-30.000 Beamte aus politischen Gründen (wegen tatsächlicher oder angeblicher Verbindungen zur Diktatur) entlassen (Washington Post 2003c), zugleich aber hohe Funktionsträger des Saddam-Regimes in Schlüsselpositionen befördert, so der neue Gouverneur von Mosul, ein belasteter Armee-General. In zahlreichen Städten wurden Kommunalwahlen vorbereitet, im letzten Moment aber durch Bremer verboten, weil ein genehmer Wahlausgang nicht garantiert werden konnte (New York Times 2003a, Washington Post 2003d). Die irakische Bevölkerung reagiert auf die Besatzungssituation differenziert. Der überwiegende Teil der Kurden hatte den Krieg Washingtons gegen den Irak begrüßt, weil man ihn als einzigen Weg zum Sturz der Diktatur ansah. Die US-Truppen wurden und werden akzeptiert und zum dauerhaften Verbleib aufgefordert, weil nur sie Sicherheit gegen die Bedrohungen aus der Türkei und dem Iran gewährleisten können, die beide eine kurdische Autonomie oder gar Selbständigkeit im Irak aus innenpolitischen Gründen mit großem Misstrauen verfolgen. Die US-Präsenz wird auch als Versicherung gegen Versuche späterer Regierungen in Bagdad betrachtet, Kurdistan wieder kontrollieren zu wollen, auch wenn ein Misstrauen gegen Washington verbreitet ist. In den arabisch-sunnitischen Siedlungsgebieten verspricht man sich von der US-Besatzung am wenigsten, hat durch diese auch kaum etwas zu gewinnen. Innerhalb der schiitischen Bevölkerung besteht eine deutliche Ambivalenz: einerseits ist man erleichtert und dankbar, dass Saddam Hussein gestürzt wurde, zugleich aber ist das Misstrauen gegenüber der US-Politik beträchtlich, der man vorwirft, die Vorherrschaft in der Region und die Kontrolle der irakischen Ölvorkommen anzustreben. Viele Schiiten fühlten sich schon im Sommer 2003 von den USA betrogen: die Versprechen seien nicht eingehalten worden, die Lebenssituation schwer erträglich. Bei arabischen Sunniten und Schiiten führen solche wachsenden Antipathien mitunter zu absurden Verschwörungstheorien, wenn etwa darüber spekuliert wird, ob nicht die USA für die Bombenanschläge auf das UN-Hauptquartier und die Imam Ali Moschee in Nadschaf verantwortlich seien. Die politische Stimmung im Irak verschlechtert sich aus zwei Gründen: zum einen lässt die Geduld der Bevölkerung mit Rechtlosigkeit und katastrophalen Lebensbedingungen nach und verringert damit den politischen Kredit der USA. Zum anderen zeitigt das das ungelöste Sicherheitsproblem (und die Reaktion der USA darauf) politische Folgen: die zahlreichen Angriffe auf US-Soldaten zwingen die Besatzungstruppen auf stärkere Distanz zur Bevölkerung, zu Misstrauen und sicherheitszentriertem Verhalten irakischen Zivilisten gegenüber. Aus dem gewollten Image der Befreier wird zunehmend das bloßer Besatzer. Wenn die Übergabe der Macht an die Iraker dauerhaft herausgezögert wird, dürfte die bisher diffuse Stimmung zu ungunsten der US-Behörden kippen. Damit aber würde das extern betriebene Nation-Building-Projekt eine wichtige Basis verlieren. Diese Entwicklung reflektiert sich inzwischen in US-amerikanischen Geheimdienstberichten: die wichtigste Bedrohung der US-Politik werde in den nächsten Monaten „der Groll einfacher Iraker sein, die der Besatzung gegenüber zunehmend feindselig werden“, wie es Beamte des Pentagon ausdrückten. Dies gelte nicht länger nur für die sunnitischen Araber, sondern auch für die schiitischen (New York Times 2003c). Auch der zivile Wiederaufbau und die Schaffung von Infrastruktur bedürfen aktiver irakischer und multilateraler Beteiligung: ohne beides können die einheimischen Personalressourcen nur ungenügend genutzt und die exorbitanten Kosten kaum aufgebracht werden. Auch hierbei erweist sich die Politik Washingtons, lokale Ressourcen und internationale Hilfe zwar nutzen, die Macht und Entscheidungsgewalt aber bei sich monopolisieren zu wollen, als Hemmschuh. Dass Washington weiterhin über kein erkennbares Konzept für ein irakisches Nation-Building verfügt, sondern sich in entschlossenem Durchwursteln versucht, ist ein weiteres wichtiges Problem. Es besteht aus zwei Gründen: erstens, weil eine Rolle des Militärs beim Nation-Building weiterhin abgelehnt wird (obschon diese Haltung angesichts der konkreten Erfordernisse gemildert wird), zweitens, weil ein kaum auflösbarer Zielkonflikt zwischen den Erfordernissen militärischer Besatzung und imperialer Kontrolle einerseits und denen einer Machtübertragung auf zivile Protagonisten und mittelfristige Nationenbildung andererseits besteht.
|
| [ Home ] [ zur Person ] [ Bücher ] [ Aufsätze ] [ Texts in English ] [ Fotos ] [ Blog ] |