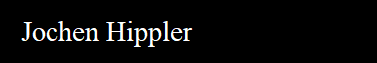

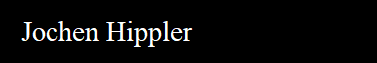 |
 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Jochen Hippler
Wer heute an einem besseren Verständnis und einer Verbesserung der Beziehungen zwischen westlich und muslimisch geprägten Ländern interessiert ist, kommt um diese Frage nicht herum, kann sie nicht ausblenden. Ein Dialog kann sie deshalb nicht vermeiden, sondern muss sie ins Zentrum stellen, wenn er nicht von vornherein als ideologisches Ablenkungsmanöver erscheinen soll. Dafür gibt es vor allem drei Gründe: erstens den nicht zu übersehenden Tatbestand, dass die Deklaration wechselseitiger Friedfertigkeit zu offensichtlich im Widerspruch zu den Tatsachen stand und steht – die sehr realen Erfahrungen von Terrorismus und Krieg lassen es nicht zu, sich durch die Erklärung guter Absichten über solche harten Realitäten hinwegzumogeln. Es fällt auf, dass terroristische Verbrechen nur zu häufig „im Namen des Islam“ oder beispielsweise der völkerrechtswidrige Irakkrieg „im Namen westlicher Werte“ (wie Demokratie) begangen wurden. Hinweise, dass die westlichen Werte der Aufklärung oder des Humanismus oder die Werte des Islam jeweils friedlich seien, überzeugen dann nur die eigene Seite, wirken für Andere aber hohl. Zweitens litten – und leiden - die Dialoge auch daran, dass sie nicht außerhalb der politischen Realität stattfinden können. Jeder neue Terrorakt und jeder neue Luftangriff auf arabische oder afghanische Zivilisten demonstrieren, dass gut gemeinte Worte und Versicherungen an der Substanz politischer Interessenskonflikte und militärischen Absichten allein nichts ändern. Anders ausgedrückt: der Dialog fand in einem engen Käfig der konfrontativen politischen Rahmenbedingungen statt, die ihn an seiner Entfaltung hindern. Solange die tatsächliche politische Gewalt immer wider die Verständigungsabsichten eines Dialoges dementiert, wird er nur sehr geringen Spielraum haben. Drittens: Die Wahl der Dialogthemen trug zusätzlich dazu bei, die Wirksamkeit des Austausches zu vermindern. Wenn Dialog auf das Feld der Religion oder auf die Diskussion allgemeiner – und notwendigerweise vager – „Werte“ verengt wird, führt ihn das leicht in ein Ghetto: Religiöse oder Wertediskussionen sind selten schädlich, reichen aber nicht aus und verlagern die Debatte zugleich ins kaum Greifbare und Sekundäre: Anstatt die harten Interessen und Konflikte ins Zentrum zu rücken, die in aller Regel zu Gewalt führen, die dann erst religiös oder durch „Werte“ gerechtfertigt wird, führen quasi-religiöse oder kulturalistische Diskurse oft zu unverbindlichen Bekenntnissen, dem Formulieren von Meinungen und Ansichten übereinander – insgesamt also auf ein Feld des Austauschs von Subjektivitäten. Wenn dieser aber von den harten politischen Erfahrungen und Realitäten getrennt bleibt, wirkt ein solcher Dialog schnell steril, irrelevant und als Ablenkungsmanöver. Dies bedeutet nicht, das interreligiöser (also hier: christlich-muslimischer) Dialog nicht wichtig sei – aber es bedeutet, dass er die Aufgabe der Religionsgemeinschaften und nicht die der Auswärtigen Kulturpolitik oder der gesamten Gesellschaften ist. Gerade auch die Fokussierung auf die interreligiöse Ebene führt leicht dazu, dass wir die Christen im Nahen Osten, die Nicht-Frommen oder säkulare muslimische Gemeinschaften wie die Alewiten selbst ausgrenzen oder deren Ausgrenzung fördern, und so den religiösen Homogenisierungsdruck in der Region noch fördern. Das kann nicht Aufgabe eines interkulturellen Dialoges sein. Dazu können unter anderem folgende Ansätze beitragen: 1. Dialog muss die Bereitschaft beinhalten, zuerst den Balken im eigenen Auge zu bemerken, bevor man den Splitter im fremden zum Thema macht. Das gilt für beide Seiten: Westliche Dialogpartner dürfen nicht verdrängen, dass auch sie für viele Menschen des Nahen und Mittleren Ostens bedrohlich erscheinen, dass die Erfahrungen des Kolonialismus, der westlichen Dominanz, der Kriege und Besetzungen durch westliches Militär oder die Unterstützung nahöstlicher Diktatoren zu Recht als Ausdruck westlicher Gewaltsamkeit erscheinen. Umgekehrt dürfen Partner aus dem Nahen und Mittleren Osten nicht ignorieren, dass aus muslimischen Gesellschaften auch Gewalttäter wie Saddam Hussein oder Usama bin Ladin erwachsen sind, dass auch aus muslimisch geprägten Ländern nach innen und außen grauenvoll Gewalttaten ausgeübt wurden und werden. 2. Dialog darf nicht allein auf die Gegenseite zielen, sondern muss auch die eigenen Denkvoraussetzungen neu reflektieren. Im Westen tun wir häufig so, als hätten sich aus der unserer Geistesgeschichte – etwa der Aufklärung – ausschließlich Werte und Praktiken der Humanität entwickelt – während die westlich geprägte Moderne tatsächlich auch gesellschaftliche Monstren wie den Stalinismus, Kolonialismus, den wissenschaftlichen Rassismus und den Faschismus hervorbrachte. Unsere Moderne, auf die wir oft so offensiv stolz sind, verfügt über ein Doppelgesicht von Humanität und bürokratischer Entmenschlichung, und wir sind keine glaubwürdigen Gesprächspartner, wenn wir nur unsere positive Tradition beschwören und die dunkle Seite unserer Geschichte unter den Teppich kehren. Umgekehrt ist es ebenso nutzlos, wenn Muslime reflexartig aus dem Islam und der muslimischen Geistestradition und Geschichte nur die Friedfertigkeit und Verständigungsbereitschaft herauslesen wollen, und Unterdrückung, Brutalität und Gewalt systematisch übersehen. Dialog muss bedeuten, auch über uns selbst neue Sichtweisen zu lernen bereit zu sein, sonst wird er leicht zum wechselseitigen Monolog. 3. Dialog muss vor allem über die schwierigen und schmerzhaften Dinge sprechen. Er muss vor allem um die tatsächlichen Konflikte, Auseinandersetzungen, Interessen und Probleme geführt werden, und darf sich dem nicht durch eine Flucht ins Abstrakte entziehen. Er muss zwar in der Form höflich und respektvoll sein, darf sich aber in der Sache gerade den schwierigen Konfliktpunkten nicht entziehen. Deshalb scheint es angebracht, gerade die politische Gewalt ins Zentrum der Debatte zu rücken – diese bestimmt die politische Tagesordnung, sie prägt die wechselseitigen Ängste voreinander und emotionalisiert die Beziehungen, sie kann deshalb nicht ausgeklammert werden, sondern muss kritisch und selbstkritisch thematisiert werden. Darüber hinaus sollte Dialog mit der Absicht konkreter Problemlösung betrieben werden und sich nicht auf bloßen Meinungsaustausch beschränken. 4. Dialoge müssen auch mit politischen Gegnern geführt werden, nicht primär mit den eigenen Spiegelbildern oder Geistesverwandten. Das galt im Kalten Krieg, als Dialog und Entspannungspolitik bedeuteten, gerade mit der Sowjetunion zu sprechen, von der sich der Westen bedroht fühlte – heute müssen auch die gesprächsbereiten islamistischen Kräfte am Dialog teilhaben. Dialog bedeutet nicht die Übernahme gegnerischer Positionen oder die politische Verbrüderung, sondern die respektvolle Auslotung von Gemeinsamkeiten und Differenzen zur Findung praktischer Lösungen – wo dies möglich ist. Sprechen wir von „westlicher“ oder „muslimischer“ Gewalt, stellt sich sofort das Problem, wen wir genau mit diesen Begriffen meinen. Wir neigen dazu, die jeweils andere Seite mit pauschalisierenden Begriffen zu belegen, auch wenn wir genau wissen, dass die eigene sehr heterogen und differenziert strukturiert ist. Was oder wen meinen wir eigentlich, wenn wir von „der muslimischen Welt“ sprechen? Es kann sich kaum um eine religiöse Begriffsbestimmung handeln, weil wir damit ja religiöse Minderheiten (z.B. Christen in Ägypten, Palästina, dem Libanon oder Hindus in Malaysia) ebenso ausschließen würden wie säkulare, agnostische oder a-religiöse Strömungen. Außerdem: wenn wir von „der muslimischen Welt“ (oder Kultur, Zivilisation, etc.) sprechen, gruppieren wir sehr unterschiedliche Gesellschaften zusammen, die objektiv und subjektiv nur wenig gemeinsam haben. Die algerische, yemenitische, pakistanische und indonesische Gesellschaften beispielsweise mögen alle vom Islam auf die eine oder andere Art geprägt worden sein, sind aber trotzdem in vielen Kernbereichen kaum vergleichbar. Sie alle in einer Gruppe begrifflich zusammenzufassen kann leicht in die Irre führen und ein Merkmal betonen, das für ihr Verständnis nicht immer zentral sein muss. Nicht selten wehren sich auch muslimische arabische Intellektuelle mit gutem Grund, von Beobachtern im Westen primär als Muslime, und nicht zuerst als Araber, als Intellektuelle, oder als z.B. Ägypter oder Marokkaner wahrgenommen zu werden. Wenn wir also pauschalisierende Begriffe – wie „die muslimische Welt“ – verwenden, gilt es, sorgfältig im Auge zu behalten, dass wir der Vielfalt und Widersprüchlichkeit der dortigen gesellschaftlichen, ethnischen, nationalen, ideologischen, religiösen, politischen und anderen Realitäten nicht wirklich gerecht werden. Das gilt in besonderem Maße, wenn wir über die Frage des Gewaltpotentials in muslimisch geprägten Gesellschaften sprechen. Aussagen darüber, wie gewalttätig oder friedfertig muslimisch geprägte – oder westliche – Gesellschaften allgemein sind, müssen also mit größter Zurückhaltung getroffen werden, wenn man sich nicht auf Klischees beschränken möchte. Das gleiche Problem der Pauschalisierung stellt sich natürlich auch bei der Verwendung der Begriffe „der Westen“ oder „westliche Gesellschaften“. „Westen“ klingt wie eine geographische Bezeichnung, meint aber einen Typus der politischen Kultur, der sich nach überwiegender Auffassung aus der griechischen Antike über das christliche Europa des Mittelalters und die Aufklärung bis zur modernen „westlichen“ Gesellschaft entwickelt habe. Zwar gibt es dabei auch eine geographische Dimension – eine so verstandene westliche Welt stammte aus Europa und hätte sich von dort auf andere Weltgegenden ausgeweitet (etwa nach Nordamerika oder Australien/Neuseeland), fokussiert aber auf ein bestimmtes Set an Philosophie, politisch-kultureller Werte und gesellschaftlicher Mechanismen. So ergeben sich allerdings zwei Problemebenen: einerseits bleibt „der Westen“ ebenso diffus, heterogen und widersprüchlich wie sein Gegenpart, die „muslimische Welt“. Skinheads, Punker und Londoner Bankiers, der Vatikan, Habermas, George Bush, Goethe und Britney Spears, Befreiungstheologen in Lateinamerika, weiße Suprematisten in den USA und europäische Atheisten – all diese und zahlreiche andere Kräfte und Persönlichkeiten gehören offensichtlich zum „Westen“, und es ist ausgesprochen schwierig, ihn inhaltlich näher zu bestimmen, wenn man nicht seine persönlichen ideologischen Vorlieben in den Begriff hineinprojizieren möchte. In diesem Zusammenhang stellt sich weiter die Frage, wer eigentlich die Subjekte eines interkulturellen Dialoges sein sollten und können. Regierungen sind selten die geeigneten Subjekte, einen solchen Dialog der Kulturen zu führen. Gerade beim diplomatischen Verkehr sind Machtaspekte besonders ausgeprägt: Regierungen stellen schließlich nichts anderes dar, als eine Bündelung und Organisierung gesellschaftlicher und staatlicher Macht. Und ihre Aufgabe besteht darin, die eigenen Interessen nach außen auch gegen Widerstände zu fördern oder durchzusetzen. Wer gegen solche Dialogpartner nicht misstrauisch wäre, ist selber Schuld. Verschärft stellt sich das Problem im Nahen und Mittleren Osten. Dort besteht immer noch ein großer Teil der Regierungen aus Diktaturen oder Pseudodemokratien, die jeweils die eigene Bevölkerung von der Macht ausschließen, unterdrücken, oder ihre Rechte einschränken. Mit genau diesen Kräften einen “Dialog” zu führen mag nützlich sein, ist oft unvermeidbar - aber kann kaum der Kern eines Dialoges der Kulturen sein. Stattdessen kommt es darauf an, noch stärker als bisher einen gesellschaftlichen anstatt diplomatischen Austausch zu erreichen, wie dies auch im früher so konfliktbeladenen deutsch-französischen Verhältnis zu einem größeren Verständnis beigetragen hat. Dialoge zwischen den Intellektuellen beider Seiten, zwischen Journalisten, Wissenschaftlern, Politikern, Schülern und Studenten und religiösen Organisationen und Gruppen der Zivilgesellschaft sind bereits im Gange, sollten aber massiv verstärkt und verstetigt werden. Kontinuität und ein gewisser Mindestumfang sind wichtig, um damit Wirkung zu erzielen. Zugleich aber darf auch von solchem Austausch nicht zu viel erwartet werden. Er kann nur gelingen, wenn auf der politischen Ebene weniger Öl ins Feuer gegossen wird, und wenn die symbolträchtigen Schlüsselkonflikte (wie Palästina und Irak) durch größeres Engagement und stärkeren Druck von außen friedlich gelöst werden. Wenn dies versäumt wird oder misslingt, kann interkultureller Dialog nur den Schaden für die Beziehungen zwischen den westlichen und muslimisch geprägten Gesellschaften begrenzen, aber nicht wirklich zu einer Verständigung führen. Der Erfolg des interkulturellen Dialoges hängt von der Schaffung positiver politischer Rahmenbedingungen ab.
weitere Texte zu interkulturellen Fragen hier
|
| [ Home ] [ zur Person ] [ Bücher ] [ Aufsätze ] [ Texts in English ] [ Fotos ] [ Blog ] |